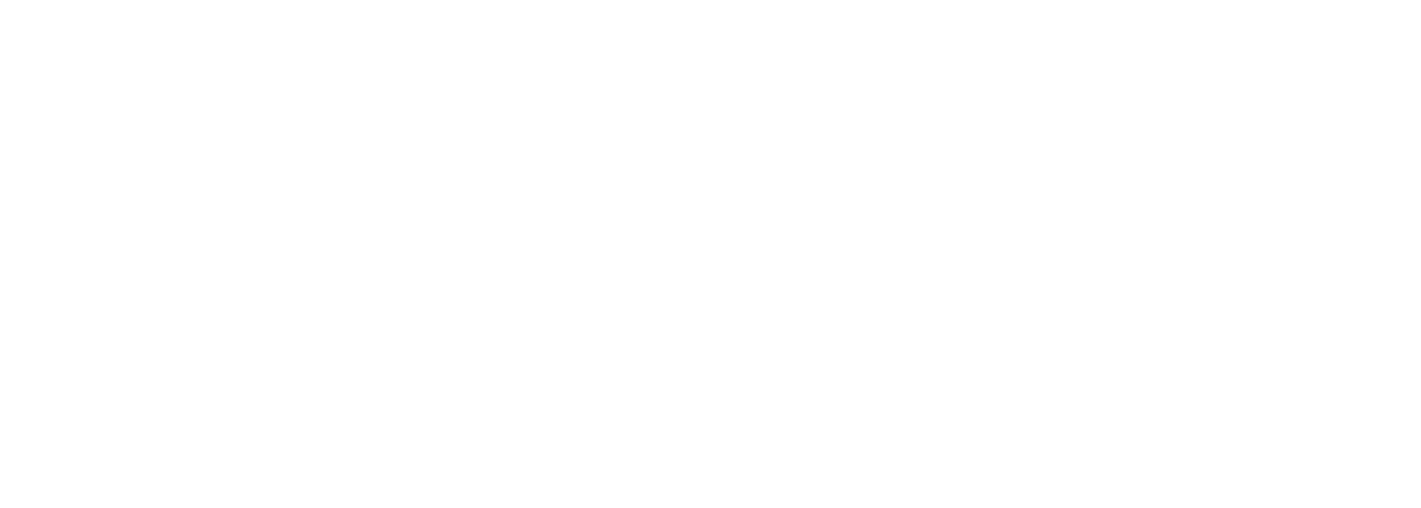Deep Dive Serie: Lautlose Gefahr: Wie Lärm unsere Ozeane krank macht (Teil 4)
- Doris Divebomber
- 31. März 2025
- 8 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 6. Aug. 2025

Von Doris Divebomber
Okay, du tapfere Seele, die es bis hierher geschafft hat! Du hast dich durch die Grundlagen des Unterwasserlärms gequält (Teil 1), die Hauptverdächtigen identifiziert (Teil 2) und die schockierenden Auswirkungen auf Wal, Fisch und sogar Plankton verdaut (Teil 3). Puh. Man könnte meinen, nach all dem Elend bleibt nur noch, die Schwimmflügel einzurollen und kollektiv den Kopf in den Sand (oder besser: Schlick) zu stecken. Aber halt! Nicht so schnell, du Landratte!
Wir, die unermüdliche Möwen-Crew der Ocean Tribune, sind nicht dafür bekannt, uns mit schlechten Nachrichten zufriedenzugeben. Unser Motto lautet schließlich "Krawall gegen die Ignoranz", und Krawall bedeutet auch, nach vorne zu schauen und zu fragen: Was zum Klabautermann können wir dagegen tun?! Denn – und das ist die vielleicht beste Nachricht dieser ganzen Serie – Lärm ist nicht wie Plastik, das Jahrhunderte im Meer bleibt, oder wie CO2, dessen Auswirkungen uns noch Generationen verfolgen werden. Wenn die Lärmquelle verstummt, ist der Lärm weg. Zack. Aus. Stille (oder zumindest: leiser). Das Problem ist also technisch lösbar! Die Frage ist nur: Haben wir den Mumm, die Intelligenz und den Willen dazu?
Also, krempel die Ärmel hoch, spitz die Ohren für die guten Töne und tauch mit uns ein in den letzten Teil unserer Deep Dive Serie:
Teil 4: Wege zur Stille – Lösungsansätze & politische Forderungen gegen den Lärm
Nachdem wir die Lärmverursacher entlarvt haben, ist es nur fair, ihnen jetzt auch mal zu sagen, wie sie gefälligst leiser werden können.
Wir gehen die Hauptverdächtigen nochmal durch, diesmal mit dem Fokus auf Lösungen:
1. Die Schifffahrt: Flüsternde Riesen und gemütliche Kähne
Der Schiffsverkehr, dieser omnipräsente Brummteppich, ist mengenmäßig der größte Brocken. Aber genau hier gibt es auch die vielversprechendsten Ansätze:
Design ist alles (vor allem beim Propeller): Erinnerst du dich an die Kavitation, das Blasen-Kollabieren am Propeller, als Hauptlärmquelle? Dagegen kann man etwas tun! Modernere, hydrodynamisch optimierte Propellerdesigns können die Kavitation und damit den Lärm deutlich reduzieren. Das ist keine Raketenwissenschaft, die Technologien gibt es. Es geht darum, sie zum Standard zu machen, nicht nur bei Neubauten, sondern auch bei Nachrüstungen (Retrofitting). Auch die Form des Schiffsrumpfes spielt eine Rolle. Ein gut designter Rumpf gleitet effizienter durchs Wasser und macht weniger Lärm.
Runter vom Gas! (Langsamfahrt ist das neue Schnell): Das ist vielleicht der einfachste und effektivste Hebel: Schiffe langsamer fahren lassen. Eine Reduzierung der Geschwindigkeit um nur 10 - 20 % kann den Unterwasserlärm eines Schiffes erheblich senken – oft um die Hälfte oder mehr (ca. 3 - 6 dB Reduktion, je nach Schiffstyp und Ausgangsgeschwindigkeit). Und das Beste daran? Langsamer fahren spart auch massiv Treibstoff und reduziert damit die CO2-Emissionen! Eine absolute Win-Win-Situation für Klima und Meeresbewohner. Warum machen das nicht alle längst? Weil Zeit auf See Geld kostet und die Logistikketten auf "just in time" getrimmt sind. Hier braucht es klare Anreize und Regeln.
Sauberkeit zahlt sich aus (akustisch): Ein verschmutzter Rumpf (Bewuchs durch Algen, Seepocken etc.) und ein rauer Propeller erhöhen den Widerstand im Wasser und damit den Lärm (und den Spritverbrauch). Regelmäßige Reinigung und Politur sind also nicht nur gut für die Effizienz, sondern auch für die Ohren der Wale.
Kluge Routenplanung: Schiffe müssen nicht unbedingt durch die Kinderstube der Wale oder die Haupt-Fressplätze von Delfinen pflügen. Durch eine bessere Routenplanung, die bekannte sensible Gebiete und Zeiten (z.B. Wanderrouten, Paarungszeiten, Kalbungsgebiete) meidet oder zumindest die Geschwindigkeit dort reduziert, kann man viel erreichen. Das erfordert aber gute Daten und internationale Koordination.
Der Druck muss steigen (politisch und wirtschaftlich): Freiwillige Richtlinien der IMO gibt es zwar schon seit 2014, aber sie sind eben nur das: freiwillig. Wir brauchen verbindliche internationale Regeln! Denkbar sind technische Vorschriften für leisere Schiffe (ähnlich wie Abgasnormen), Geschwindigkeitsbegrenzungen in bestimmten Gebieten oder generell, sowie ökonomische Anreize: niedrigere Hafengebühren für leisere Schiffe, ein "Quiet Ship"-Label, das Reedereien nutzen können, um sich positiv abzuheben. Hier müssen Regierungen und Hafenbehörden endlich handeln.
2. Sonar: Von der akustischen Keule zum Flüstermodus?
Beim Militärsonar wird's knifflig, denn hier geht es um nationale Sicherheit (sagen die Militärs). Aber auch hier gibt es Spielraum:
Augen auf bei der Übungsplanung: Der wichtigste Punkt ist die Vermeidung. Marineübungen mit Hochleistungssonar dürfen nicht in bekannten wichtigen Lebensräumen von lärmempfindlichen Arten (insbesondere Schnabelwale!) oder während kritischer Zeiten (Paarung, Kalbung) stattfinden. Es braucht verbindliche "Sonar-freie Zonen" und Zeitfenster.
Leiser treten, wenn möglich: Muss das Sonar immer mit voller Pulle laufen? Oft gibt es die Möglichkeit, die Sendeleistung zu reduzieren, wenn die taktische Situation es erlaubt.
Alternative Technologien: Gibt es Alternativen zur U-Boot-Jagd mit ohrenbetäubendem Krach? Die Forschung an passiven Sonarsystemen (die nur lauschen) und vielleicht sogar an nicht-akustischen Ortungsmethoden sollte intensiviert werden. Ob das realistisch ist, steht auf einem anderen Blatt, aber die Frage muss gestellt werden.
Mehr Transparenz und Monitoring: Militärische Geheimhaltung darf kein Deckmantel für Umweltzerstörung sein. Es braucht mehr Transparenz über geplante Übungen und ein unabhängiges Monitoring der Auswirkungen auf die Meeresumwelt, inklusive sofortiger Stopps bei Anzeichen von Schäden (z.B. nahende Wale).

Ziviles Sonar: Mit Augenmaß: Auch bei Echoloten und Fischfindern gilt: niedrigste notwendige Sendeleistung verwenden, Einsatz in sensiblen Gebieten minimieren.
3. Seismische Untersuchungen: Schluss mit der Knallerei!
Die Suche nach Öl und Gas mit Airguns ist akustische Folter für die Ozeane. Hier sind die Forderungen klar:
Der beste Lärm ist kein Lärm: Ausstieg aus Fossilen! Die radikalste und nachhaltigste Lösung ist natürlich, gar nicht erst nach neuem Öl und Gas im Meer zu suchen. Der Übergang zu erneuerbaren Energien muss beschleunigt werden, dann erübrigen sich diese brutalen Erkundungsmethoden von selbst. Jede neue Lizenz für seismische Tests ist ein weiterer Sargnagel für die Meere und das Klima.
Umstieg auf leisere Alternativen: Es gibt sie! Die Marine Vibroseis-Technologie zum Beispiel. Statt einer plötzlichen Explosion nutzt sie kontrollierte, länger andauernde Vibrationen, um den Untergrund zu erkunden. Diese Methode ist deutlich leiser (vor allem fehlen die extremen Schalldruckspitzen der Airguns) und hat nach bisherigen Erkenntnissen wesentlich geringere Auswirkungen auf Meereslebewesen. Warum wird sie nicht längst flächendeckend eingesetzt? Weil die Industrie zögert (Kosten, etablierte Verfahren) und der politische Wille fehlt, den Umstieg vorzuschreiben. Das muss sich ändern!
Wenn schon Airguns (was wir ablehnen!), dann mit maximaler Vorsicht: Solange diese Technologie noch eingesetzt wird, braucht es extrem strenge Auflagen:
Verbot in Schutzgebieten und bekannten kritischen Habitaten.
Zeitliche Beschränkungen (z.B. nicht während der Fortpflanzungs- oder Wanderungszeiten).
Obligatorische "Soft Starts": Langsames Hochfahren der Lautstärke, um Tieren die Chance zur Flucht zu geben.
Umfassendes Monitoring durch unabhängige Beobachter (visuell und akustisch) und sofortiger Stopp der Aktivität, wenn Meeressäuger oder andere gefährdete Arten in der Nähe gesichtet werden.
Einsatz der leisesten verfügbaren Airgun-Konfiguration.
4. Bau & Betrieb von Offshore-Anlagen: Die leise Baustelle
Der Ausbau der Offshore-Windenergie ist wichtig fürs Klima, aber er darf nicht auf Kosten der Meeresbewohner gehen. Hier muss Lärmschutz von Anfang an mitgedacht werden:
Schluss mit dem lauten Hämmern: Das extrem laute Rammen (Pile Driving) von Fundamenten muss durch leisere Alternativen ersetzt werden, wo immer es technisch möglich ist. Dazu gehören:
Blasenschleier: Ringe aus perforierten Schläuchen werden um die Rammstelle gelegt und Luft wird hindurchgepumpt. Der entstehende Vorhang aus Luftblasen dämpft den Schall erheblich (bis zu 15 - 20 dB Reduktion möglich). Diese Technik ist erprobt und sollte Standard sein.
Blasenvorhang gegen Lärm bei Offshorearbeiten Hydro-Schalldämpfer: Große Manschetten oder Hüllen um den Rammhammer, die den Schall im Wasser reduzieren.
Alternative Fundamenttypen: Schraubfundamente, Schwergewichtsfundamente oder Suction Buckets (die sich durch Unterdruck im Boden festsaugen) kommen oft ohne oder mit deutlich weniger Rammenergie aus.
Vibrationsrammen: Pfähle werden durch Vibration in den Boden gebracht, was meist leiser ist als das Schlagen mit dem Hammer.
Gute Planung ist halb gewonnen: Bei der Standortwahl für Windparks müssen ökologisch sensible Gebiete und Zeiten (Laich-, Brut-, Wanderzeiten) berücksichtigt und gemieden werden. Kumulative Effekte (mehrere Baustellen gleichzeitig in einer Region) müssen bewertet werden.
Verbindliche Lärmschutzgrenzwerte: In einigen Ländern (wie Deutschland) gibt es bereits gesetzliche Grenzwerte für den Lärm bei Offshore-Rammarbeiten. Diese müssen international übernommen, streng kontrolliert und bei Bedarf verschärft werden.
Übergreifende Strategien: Das große Ganze im Blick
Neben den spezifischen Lösungen für die Hauptquellen brauchen wir einen ganzheitlichen Ansatz:
Wir müssen wissen, was los ist (Monitoring & Kartierung): Wir brauchen dringend mehr und bessere Daten über die Lärmpegel in den Ozeanen. Wo ist es wann wie laut? Langfristige Messstationen, standardisierte Messmethoden und die Erstellung von Lärmkarten (ähnlich wie bei Luftverschmutzung) sind essenziell, um Problemzonen zu identifizieren und den Erfolg von Maßnahmen zu überprüfen.

Klare Ansagen (Grenzwerte & Ziele): Wir brauchen rechtlich verbindliche Grenzwerte für Unterwasserlärm – sowohl für den permanenten Hintergrundlärm als auch für laute Einzelereignisse. Die EU hat mit der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL) einen Schritt in diese Richtung gemacht, indem sie "guten Umweltzustand" auch für Unterwasserlärm fordert. Das muss aber mit konkreten, messbaren Zielen und harten Grenzwerten untermauert werden – und zwar global!
Ordnung im Raum (Marine Raumordnung): Lärm muss ein fester Bestandteil der marinen Raumordnung werden. Das bedeutet: Ausweisung von akustischen Schutzgebieten ("Quiet Zones"), lärmsensible Routenführung für Schiffe, strategische Platzierung von lärmintensiven Aktivitäten weg von sensiblen Bereichen.
Alle in einem Boot (Internationale Zusammenarbeit): Schallwellen machen nicht an Ländergrenzen halt. Deshalb sind internationale Abkommen und koordiniertes Handeln (z.B. über die IMO, regionale Meeresschutzabkommen wie OSPAR oder HELCOM, UN-Organisationen) unerlässlich.
Hirnschmalz gefragt (Forschung & Innovation): Wir brauchen mehr Forschung, um die Auswirkungen von Lärm noch besser zu verstehen (insbesondere auf Fische und Wirbellose) und um noch leisere Technologien zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen.
Mach Lärm für die Stille! (Öffentlichkeit & Druck): Und hier kommst du ins Spiel! Und wir von der Tribune. Wir müssen das Bewusstsein für dieses unsichtbare Problem schärfen. Informiere dich, sprich darüber, teile Artikel wie diesen. Unterstütze Umweltorganisationen, die sich für leisere Meere einsetzen. Frage bei Reedereien, Reiseveranstaltern und Politikern nach, was sie gegen Unterwasserlärm tun. Mach Druck! Nur wenn das Thema auf der öffentlichen und politischen Agenda steht, wird sich etwas bewegen.
Fazit für Teil 4 (und die ganze Serie): Es ist laut, aber nicht hoffnungslos!
So, das war unser Deep Dive in die lärmende Unterwasserwelt. Wir haben gesehen, dass der Mensch die Ozeane nicht nur mit Plastik und Chemie, sondern auch mit einer ohrenbetäubenden Kakophonie verschmutzt. Wir haben die Täter identifiziert und die tragischen Folgen für die Meeresbewohner beleuchtet. Aber wir haben auch gesehen: Es gibt Lösungen! Technische Innovationen, klügere Planung, operative Änderungen und vor allem der politische Wille können die Ozeane wieder leiser machen.
Es liegt an uns allen – Politik, Industrie, Wissenschaft und jeder einzelne Bürger –, diesen Willen aufzubringen und zu handeln. Die Technologie für leisere Schiffe existiert. Alternativen zu seismischen Airguns sind verfügbar. Methoden zur Lärmminderung beim Bau sind bekannt. Was fehlt, ist oft der Druck, sie konsequent einzusetzen und verbindlich vorzuschreiben.
Lass uns also nicht länger weg- oder überhören, was unter der blauen Oberfläche passiert. Lass uns den "Krawall gegen die Ignoranz" in einen "Krawall für die Stille" verwandeln. Fordern wir leisere Technologien, strengere Regeln und mehr Respekt für die akustische Integrität der Ozeane. Denn ein leiserer Ozean ist ein gesünderer Ozean – für die Wale, die Fische, das Plankton und letztendlich auch für uns.
Die Möwen-Crew meldet sich ab für diesen Deep Dive. Bleib laut im Protest, aber leise im Handeln, wo es der Umwelt dient!
Hier geht's zu den anderen Teilen:
Quellen:
IMO (International Maritime Organization): Richtlinien zur Reduzierung von Unterwasserlärm durch Schiffe (MEPC.1/Circ.833) & laufende Arbeiten im MEPC-Komitee.
EU Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL): Beschreibt "guten Umweltzustand" für Unterwasserlärm (Descriptor 11).
OSPAR und HELCOM: Regionale Meeresschutzübereinkommen, die sich mit Unterwasserlärm befassen.
Technische Lösungen für Schiffe: Veröffentlichungen von Werften, Propellerherstellern, Forschungsinstituten (z.B. zum optimierten Propellerdesign, Rumpfformen).
Betriebliche Maßnahmen: Studien zu den Lärm- und Emissionsvorteilen von Langsamfahrt (Slow Steaming).
Lärmminderungstechniken Offshore-Bau: Berichte von Umweltbehörden (z.B. Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie - BSH in Deutschland), Umweltgutachten, Studien zu Blasenschleiern, Hydro-Schalldämpfern.
Alternative seismische Technologien: Veröffentlichungen zu Marine Vibroseis.
Nationale Gesetzgebung: Beispiele wie die deutschen Vorschriften zum Lärmschutz beim Offshore-Rammen.
NGOs und Umweltorganisationen: OceanCare, NRDC, IFAW, WWF, NABU (Meeresschutz) – Kampagnen und Berichte zu Lösungsansätzen und politischen Forderungen.
Wissenschaftliche Fachartikel und Berichte: Studien zu den Vorteilen von Lärmreduktion, marine Raumordnung und akustischen Schutzgebieten.
DOSITS, NOAA Fisheries: Informationen und Ressourcen zu Lösungsansätzen.
Klartext braucht eine starke Crew.
The Ocean Tribune ist zu 100% unabhängig, werbefrei und für alle frei zugänglich. Wir lassen uns von keiner Lobby kaufen, weil wir nur einer Sache verpflichtet sind: dem Ozean.
Das ist nur möglich, weil eine Crew von unerschrockenen Unterstützern hinter uns steht, die diesen Kurs finanziert. Wenn du unsere Arbeit wertvoll findest, dann werde jetzt Teil dieser Bewegung. Jeder Beitrag ist Treibstoff für unsere Mission und sorgt dafür, dass wir weiter die unbequemen Wahrheiten aussprechen können.
Aus der Werkstatt: Vom Problem zur Lösung
Aufklärung ist der erste Schritt. Die Umsetzung der zweite. Wir bei Vita Loom Labs entwickeln die professionellen Werkzeuge und strategischen Prozesse, die Impact-Organisationen dabei helfen, ihre Missionen wirkungsvoller zu machen.
Sie wollen sehen, wie unser strategischer Prozess in der Praxis aussieht? Unsere 'Blueprint Case Study' demonstriert Schritt für Schritt, wie wir aus einer guten Idee einen unwiderstehlichen, förderfähigen Antrag schmieden.
The Ocean Tribune
Wir wissen, was die Ozeane zu sagen haben!
Bildquellen:
Abbildung 1: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48583320
Abbildung 2: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shipping_routes_red_black.png