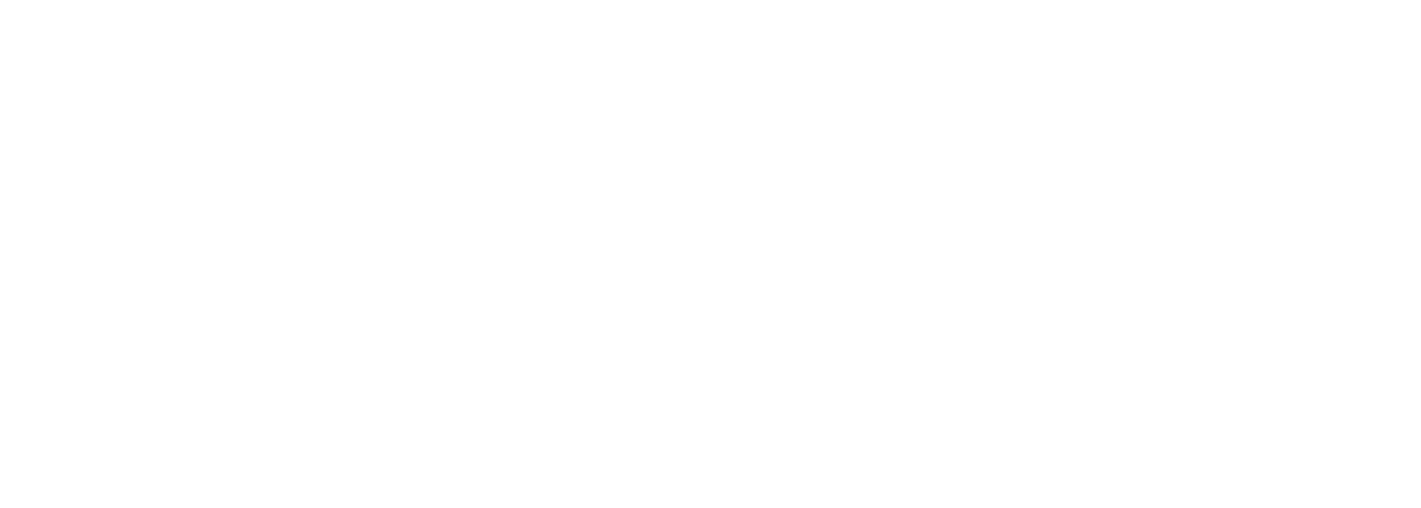Deep Dive Serie: Lautlose Gefahr: Wie Lärm unsere Ozeane krank macht (Teil 2)
- Doris Divebomber
- 31. März 2025
- 9 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 6. Aug. 2025

Von Doris Divebomber
Ahoi, du Lärm-sensibilisierter PRO-Leser und willkommen zurück an Deck der Ocean Tribune! Oder sollten wir sagen: Willkommen zurück im Maschinenraum des Grauens? Denn nachdem wir in Teil 1 unserer Deep Dive Serie "Lautlose Gefahr: Wie Lärm unsere Ozeane krank macht" geklärt haben, was dieser unsichtbare Krach unter Wasser eigentlich ist und warum er so kriminell unterschätzt wird, zoomen wir heute mal ran. Wir wollen wissen: Wer sind die Hauptverdächtigen? Wer sind die akustischen Umweltverschmutzer, die unsere Ozeane in eine ohrenbetäubende Disco verwandeln, in der kein Wal mehr den nächsten Blues hören kann?
Schnall dich an, denn wir präsentieren dir die Top-Hits der maritimen Lärmbelästigung. Das wird kein gemütlicher Törn, eher eine Fahrt durch die akustische Hölle. Aber hey, wir sind ja hier, um Krawall gegen die Ignoranz zu machen, also: Lautstärke auf (metaphorisch, bitte!) und los geht’s mit ...
Teil 2: Schifffahrt, Sonar & Co. – Die Hauptquellen des Krachs (Lärm)
Erinnerst du dich an die nette Kneipen-Analogie aus Teil 1? Der konstante Lärmpegel, der jede vernünftige Unterhaltung unmöglich macht? Tja, die größten Beitragszahler zu diesem Grundrauschen, diesem permanenten akustischen Smog in den Weltmeeren, sind ohne Zweifel unsere schwimmenden Stahlkolosse.
1. Die Schifffahrt: Das allgegenwärtige Brummen des globalen Handels (und Vergnügens)
Stell dir vor, die Ozeane sind die Autobahnen unseres Planeten. Und auf diesen Autobahnen herrscht reger Verkehr. Sehr reger Verkehr. Rund um die Uhr. Über 90% des Welthandels werden über den Seeweg abgewickelt. Das bedeutet Zehntausende von riesigen Containerschiffen, Tankern, Frachtern, Fähren und Kreuzfahrtschiffen, die permanent kreuz und quer über die Meere pflügen.
Die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO) schätzt die globale Handelsflotte auf weit über 50.000 Schiffe (Stand 2021, Tendenz steigend), und da sind die unzähligen kleineren Kutter, Fischerboote und Freizeitjachten noch gar nicht mitgezählt.

Und was machen all diese Schiffe? Sie machen Lärm. Und zwar nicht zu knapp. Die Hauptlärmquelle bei den meisten großen Schiffen ist der Propeller. Genauer gesagt, ein Phänomen namens Kavitation. Wenn sich der Propeller dreht, entstehen an den Blattspitzen Bereiche mit sehr niedrigem Druck. Dort beginnt das Wasser quasi zu "kochen", es bilden sich winzige Dampfblasen. Sobald diese Blasen in Bereiche mit höherem Druck gelangen (also quasi sofort), kollabieren sie explosionsartig. Das erzeugt ein lautes, breitbandiges Geräusch – ein permanentes Rauschen, Brummen und Dröhnen. Je schneller der Propeller dreht und je größer er ist, desto mehr Kavitation und desto mehr Lärm.
Hinzu kommt der Lärm der Maschinen an Bord (Motoren, Generatoren, Pumpen), der sich durch den Schiffsrumpf ins Wasser überträgt, sowie das Geräusch des Wassers, das am Rumpf entlangströmt.
Das Fatale daran: Der Lärm von großen Schiffen liegt hauptsächlich im niederfrequenten Bereich (typischerweise unter 1000 Hertz, oft sogar unter 100 Hz). Und wie wir in Teil 1 gelernt haben, breiten sich gerade diese tiefen Töne unter Wasser extrem weit aus. Ein einziges großes Containerschiff kann einen Lärmpegel von 180 - 190 dB (re 1 μPa @ 1m) erzeugen. Das ist lauter als ein startendes Düsenflugzeug, wenn man daneben stehen würde (wobei der Vergleich wegen der unterschiedlichen Medien hinkt, aber die Intensität ist enorm).
Dieser tieffrequente Schall kann hunderte, sogar tausende Kilometer weit durch den Ozean reisen und trägt maßgeblich zur Erhöhung des globalen Hintergrundlärmpegels bei.
Genau dieser Hintergrundlärm ist es, der sich laut wissenschaftlichen Schätzungen seit den 1950er Jahren in vielen Gebieten etwa alle zehn Jahre verdoppelt hat (ein Anstieg um ca. 3 Dezibel pro Dekade). Das bedeutet, dass die "Kommunikationsreichweite" für viele Meerestiere, insbesondere für Großwale, die ebenfalls im niederfrequenten Bereich kommunizieren, dramatisch geschrumpft ist. Stell dir vor, du könntest dich nur noch mit Leuten im selben Raum unterhalten, anstatt wie früher quer durch die ganze Stadt zu rufen. Das ist die Realität für viele Wale heute.
Die Schifffahrt ist also der Hauptverursacher des chronischen Lärmstresses in den Ozeanen. Ein permanentes Grundrauschen, das die natürliche Klanglandschaft überdeckt und die akustische Wahrnehmung von Meereslebewesen massiv beeinträchtigt. Und der Trend zeigt leider nach oben: mehr Schiffe, größere Schiffe, teils schnellere Schiffe (obwohl es Bemühungen zur Effizienzsteigerung gibt, die auch die Geschwindigkeit reduzieren können – ein kleiner Hoffnungsschimmer, dazu mehr in Teil 4). Auch die Erschließung neuer Schifffahrtsrouten, zum Beispiel in der Arktis durch das schmelzende Eis, bringt den Lärm in bisher relativ stille Regionen.
2. Sonar: Die akustische Keule für Militär und Forschung
Wenn die Schifffahrt das ständige Hintergrundbrummen ist, dann ist Sonar der plötzliche, ohrenbetäubende Schrei. Sonar (SOund Navigation And Ranging) ist eine Technik, die Schallwellen aussendet und deren Echos empfängt, um Objekte unter Wasser zu orten, den Meeresboden zu kartieren oder zu kommunizieren. Man unterscheidet zwischen passivem Sonar (das nur lauscht) und aktivem Sonar (das selbst Schall aussendet). Und genau dieses aktive Sonar ist das Problem.
Die Hauptnutzer von leistungsstarkem aktivem Sonar sind die Marinen weltweit. Vor allem zwei Typen sind berüchtigt:
Mittelfrequenz-Aktivsonar (MFAS): Wird typischerweise im Frequenzbereich von 1 bis 10 Kilohertz eingesetzt, hauptsächlich zur U-Boot-Jagd und zur Ortung von Minen. Diese Sonare können extrem laut sein, mit Quellpegeln von über 235 Dezibel (re 1 μPa @ 1m). Das sind Schallintensitäten, die weit über der Schmerzgrenze liegen (wenn es denn eine für uns unter Wasser gäbe) und nachweislich schwere Auswirkungen auf Meeressäuger haben.
Niederfrequenz-Aktivsonar (LFAS): Arbeitet im Bereich unter 1 Kilohertz und wird verwendet, um U-Boote über sehr große Entfernungen (hunderte von Kilometern) aufzuspüren. Die Schallpegel sind ähnlich exorbitant hoch, und die tiefen Frequenzen breiten sich noch weiter aus als die von MFAS.

Der Einsatz dieser Sonarsysteme, oft während militärischer Übungen, wurde wiederholt mit Massenstrandungen von Walen und Delfinen in Verbindung gebracht, insbesondere von tief tauchenden Schnabelwalen.
Berühmte Beispiele sind die Strandungen auf den Bahamas (2000), den Kanarischen Inseln (mehrfach, u.a. 2002), in Griechenland und an anderen Orten. Die intensiven Schallwellen scheinen die Tiere in Panik zu versetzen, was zu Verhaltensänderungen führt, die die Taucherkrankheit (Dekompressionskrankheit) auslösen können, oder sie verursachen direkte physische Schäden am Gehör oder anderen Organen. Die genauen Mechanismen werden noch erforscht, aber der Zusammenhang gilt als gesichert. Das Problem: Militärische Aktivitäten unterliegen oft der Geheimhaltung, und Informationen über den genauen Zeitpunkt und Ort von Sonar-Einsätzen sind schwer zu bekommen, was die Forschung und Regulierung erschwert.
Aber nicht nur das Militär nutzt aktives Sonar. Auch in der zivilen Schifffahrt (Echolote zur Tiefenmessung, Fischfinder), in der Fischerei (zur Ortung von Fischschwärmen) und in der Meeresforschung (zur Kartierung des Meeresbodens oder zur Untersuchung von Wasserschichten) kommt es zum Einsatz. Diese Systeme sind in der Regel weniger leistungsstark als militärische Sonare, tragen aber in ihrer Summe ebenfalls zur Lärmbelastung bei, insbesondere in küstennahen Gebieten oder auf Forschungsrouten.
3. Seismische Untersuchungen: Die Suche nach Öl und Gas mit akustischem Dauerbeschuss
Wenn du dachtest, Militärsonar sei laut, dann halte dich fest. Für die Suche nach Öl- und Gasvorkommen unter dem Meeresboden setzt die Industrie eine Methode ein, die an Brutalität kaum zu überbieten ist: seismische Airguns.
Stell dir ein Schiff vor, das ein ganzes Netzwerk von riesigen "Luftkanonen" (Airguns) hinter sich herzieht. Diese Kanonen feuern alle 10 bis 15 Sekunden gebündelte Druckluft ins Wasser. Diese Explosion erzeugt eine extrem laute Schallwelle – oft über 250 Dezibel (re 1 μPa @ 1m) nahe der Quelle –, die tief in den Meeresboden eindringt. Die von den verschiedenen Gesteinsschichten reflektierten Schallwellen werden dann von langen Mikrofonkabeln (Streamern), die ebenfalls hinter dem Schiff hergeschleppt werden, aufgefangen. Aus diesen Echos können Geologen dann auf die Struktur des Untergrunds schließen und potenzielle Lagerstätten identifizieren.
Das Problem:
Diese Schall-"Explosionen" sind mit die lautesten Geräusche, die der Mensch überhaupt im Meer erzeugt. Und sie finden nicht nur einmal statt, sondern alle paar Sekunden, 24 Stunden am Tag, oft über Wochen oder Monate hinweg, während das Schiff systematisch riesige Meeresgebiete abfährt.
Der Lärm ist so intensiv, dass er nicht nur in der direkten Umgebung verheerend wirkt, sondern auch noch Hunderte und Tausende von Kilometern entfernt deutlich hörbar ist und den Hintergrundlärmpegel massiv erhöht.
Die Auswirkungen auf Meereslebewesen sind dramatisch und weitreichend. Von der Störung der Kommunikation und des Verhaltens von Walen und Delfinen (die oft über Hunderte von Kilometern aus den beschallten Gebieten fliehen) über nachgewiesene Schäden am Gehör von Fischen bis hin zu massiven Sterberaten bei Zooplankton (winzige Organismen an der Basis der Nahrungskette), wie neuere Studien zeigen. Wenn das Zooplankton in einem Umkreis von über einem Kilometer um die Airgun herum abstirbt, hat das potenziell katastrophale Folgen für das gesamte Ökosystem.
Seismische Untersuchungen sind ein Paradebeispiel für eine extrem invasive und lärmintensive Aktivität, die für einen einzigen Zweck – die fossile Brennstoffgewinnung – riesige Meeresbereiche akustisch verwüstet.
4. Bau und Betrieb von Offshore-Anlagen: Die Unterwasser-Baustelle
Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien (gut!) und der fortschreitenden Erschließung maritimer Ressourcen (weniger gut?) kommt eine weitere wachsende Lärmquelle hinzu: der Bau und Betrieb von Anlagen im Meer.
Offshore-Windparks: Der Bau von Windrädern im Meer erfordert oft das Einbringen riesiger Fundamente in den Meeresboden. Die gängigste Methode ist das Rammen (Pile Driving). Dabei werden massive Stahlpfähle mit hydraulischen Hämmern in den Grund geschlagen. Jeder einzelne Schlag erzeugt einen extrem lauten Impulsschall, der sich weit unter Wasser ausbreitet und für Meerestiere in der Nähe gefährlich bis tödlich sein kann. Zwar gibt es inzwischen Auflagen und Techniken zur Lärmminderung (z.B. Blasenschleier), aber der Bau bleibt eine erhebliche akustische Belastung. Auch der Betrieb der Windräder erzeugt übrigens Unterwasserlärm, wenn auch auf deutlich niedrigerem Niveau.
Pile driving für Offshore Öl- und Gasplattformen: Der Bau, Betrieb und auch der Rückbau von Bohrinseln und Förderplattformen ist mit Lärm verbunden – von den Bohrgeräuschen selbst über Versorgungsschiffe bis hin zu Unterwasserarbeiten.
Andere Bauaktivitäten: Dazu zählen das Verlegen von Pipelines und Unterseekabeln, der Bau von Brücken, Tunneln und Hafenanlagen sowie Baggerarbeiten zur Vertiefung von Fahrrinnen. All diese Aktivitäten bringen Maschinen, Schiffe und oft auch impulsive Geräusche (wie beim Rammen oder bei Sprengungen) ins marine Ökosystem.
Gerade der Ausbau der Offshore-Windenergie stellt uns vor ein Dilemma:
Wir brauchen erneuerbare Energien, um den Klimawandel (eine weitere massive Bedrohung für die Ozeane) zu bekämpfen, aber der Bau dieser Anlagen verursacht Lärm, der die Meeresumwelt schädigt.
Hier sind intelligente Lösungen und strenge Regulierungen gefragt (mehr dazu in Teil 4).
5. Der Rest vom Lärmfest: Kleinboote, Pingers und Explosionen
Neben den "Big Four" gibt es noch eine Reihe weiterer Lärmquellen, die lokal oder zeitweise eine Rolle spielen:
Kleinere Schiffe und Boote: Tausende von Fischerbooten, Freizeitbooten, Jetskis etc. verursachen zwar einzeln weniger Lärm als ein Supertanker, aber in ihrer Summe können sie gerade in küstennahen Gewässern, Buchten und Flussmündungen, die oft wichtige Lebensräume für Jungfische oder Meeressäuger sind, zu einer erheblichen Lärmbelästigung führen. Ihr Lärm liegt oft auch in höheren Frequenzbereichen, die z.B. für Delfine relevant sind.
Akustische Vergrämungsgeräte (Acoustic Deterrent Devices - ADDs oder "Pingers"): Das ist die Ironie schlechthin. Diese Geräte werden in der Fischerei oder Aquakultur eingesetzt, um Meeressäuger (wie Robben oder Schweinswale) von Netzen oder Zuchtanlagen fernzuhalten, indem sie unangenehme Töne aussenden. Sie sollen also eigentlich schützen, tragen aber selbst zur Lärmverschmutzung bei und können die Tiere aus wichtigen Nahrungsgründen vertreiben oder ihr Verhalten stören.
Unterwassersprengungen: Werden z.B. beim Rückbau von Anlagen, bei Hafenbauarbeiten oder bei militärischen Übungen (Minenräumung) eingesetzt. Die Auswirkungen sind, wie man sich vorstellen kann, extrem und oft tödlich für Tiere in der Nähe.
Fazit für Teil 2: Ein ohrenbetäubender Cocktail
Puh, das war ein Ritt durch die Lärmquellen-Hitliste. Wir haben gesehen: Es ist ein bunter, aber leider sehr lauter Cocktail, den wir unseren Ozeanen da zumuten.
Die Schifffahrt sorgt für das chronische, globale Hintergrunddröhnen, das die Kommunikation erschwert.
Militärisches Sonar schlägt mit brutaler Intensität zu und kann direkt zu Strandungen führen.
Seismische Untersuchungen beschallen riesige Gebiete über Wochen mit explosiven Lautstärken und schädigen das gesamte Nahrungsnetz.
Bauaktivitäten, insbesondere das Rammen für Windparks, fügen dem Lärm-Mix laute Impulsgeräusche hinzu.
Und unzählige kleinere Quellen tragen lokal und kumulativ zur Belastung bei.
Das Schlimmste daran: Diese Lärmquellen existieren nicht isoliert. Oft überlagern sie sich, verstärken sich gegenseitig und setzen die Meeresbewohner einem permanenten, vielfältigen akustischen Stress aus.
Jetzt, da wir die Täter identifiziert haben, brennt natürlich die Frage: Was genau richtet dieser ganze Krach denn nun bei Walen, Fischen, Robben und sogar bei den kleinsten Meeresorganismen an? Welche konkreten Auswirkungen hat der Lärm auf ihr Verhalten, ihre Gesundheit, ihr Überleben?
Genau das werden wir im dritten Teil unserer Deep Dive Serie beleuchten: "Gestresste Wale, verwirrte Fische – Auswirkungen auf Meeresbewohner". Sei gespannt auf eine Reise in die gestörte Wahrnehmungswelt der Ozeanbewohner. Es wird nicht weniger beunruhigend, aber verdammt wichtig.
Bleib uns gewogen und halte die Ohren steif (oder schütz sie lieber)!
Hier geht's zu den anderen Teilen:
Quellen:
IMO (International Maritime Organization) (Richtlinien & Berichte zu Schifffahrtslärm)
Ross, D. (1976) - "Mechanics of Underwater Noise" (Standardwerk Schiffslärm)
Oceana (Organisation & Website, Fokus Schifffahrtslärm)
Wissenschaftliche Studien zu Sonar-Auswirkungen (z.B. Frantzis, 1998; Jepson et al., 2003)
International Whaling Commission (IWC) (Berichte zu Lärmauswirkungen auf Wale)
NOAA (US-Behörde, Forschung & Regulierung Sonar)
NRDC / IFAW / OceanCare (Berichte zu Sonar-Vorfällen)
Richardson et al. (1995) - "Marine mammals and noise" (Standardwerk, u.a. Airguns)
Gordon et al. (2003) - Review zu Effekten seismischer Surveys
McCauley et al. (2017) - Studie zu Airgun-Auswirkungen auf Zooplankton
Greenpeace / WWF (Kampagnen & Berichte zu Seismik)
OSPAR Commission (Richtlinien zu Lärm, inkl. Rammarbeiten)
Deutsche Regularien (BMUV/BSH) (Beispiel für Lärmgrenzwerte Offshore-Bau)
Wissenschaftliche Studien zu Rammlärm-Auswirkungen (z.B. Brandt et al., 2011)
DOSITS (Discovery of Sound in the Sea) (Infos zu diversen Lärmquellen)
Klartext braucht eine starke Crew.
The Ocean Tribune ist zu 100% unabhängig, werbefrei und für alle frei zugänglich. Wir lassen uns von keiner Lobby kaufen, weil wir nur einer Sache verpflichtet sind: dem Ozean.
Das ist nur möglich, weil eine Crew von unerschrockenen Unterstützern hinter uns steht, die diesen Kurs finanziert. Wenn du unsere Arbeit wertvoll findest, dann werde jetzt Teil dieser Bewegung. Jeder Beitrag ist Treibstoff für unsere Mission und sorgt dafür, dass wir weiter die unbequemen Wahrheiten aussprechen können.
Aus der Werkstatt: Vom Problem zur Lösung
Aufklärung ist der erste Schritt. Die Umsetzung der zweite. Wir bei Vita Loom Labs entwickeln die professionellen Werkzeuge und strategischen Prozesse, die Impact-Organisationen dabei helfen, ihre Missionen wirkungsvoller zu machen.
Sie wollen sehen, wie unser strategischer Prozess in der Praxis aussieht? Unsere 'Blueprint Case Study' demonstriert Schritt für Schritt, wie wir aus einer guten Idee einen unwiderstehlichen, förderfähigen Antrag schmieden.
The Ocean Tribune
Wir wissen, was die Ozeane zu sagen haben!