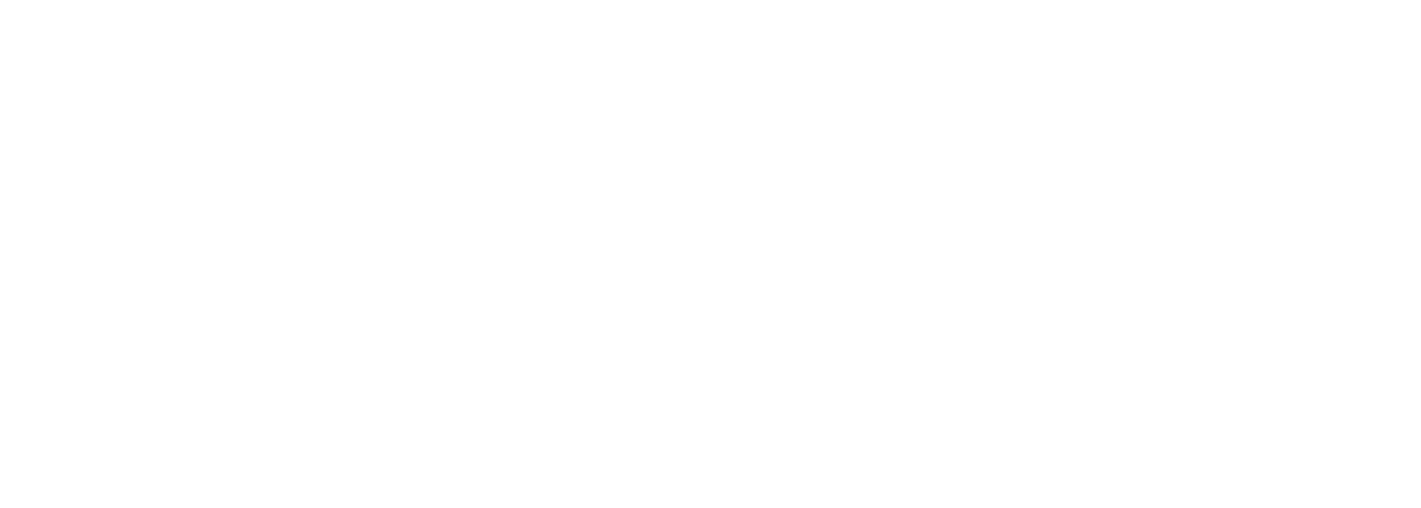Was wäre, wenn wir einfach ZAP! weg wären und die Meere 286.411 Jahre bräuchten, um unseren Saustall zu beseitigen?
- Barry Birdbrain
- 18. Mai 2025
- 15 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 6. Aug. 2025

Von Barry Birdbrain
Okay, mein lieber aquatischer Aficionados und Gezeiten-Guru, schnall die Taucherbrille fest und prüf den Sauerstoffgehalt deiner Lachmuskeln! Wir begeben uns auf ein Gedankenexperiment der Kategorie "Was wäre, wenn ... wir einfach kollektiv den Löffel abgeben?". Aber nicht so ein langsames, würdevolles Dahinsiechen, nein, wir reden hier von einem kosmischen "ZAP!" – und poof, die Menschheit ist Geschichte. Verdampft. Als hätten wir nie existiert, außer dass wir, nun ja, einen Saustall hinterlassen haben, der selbst eine Horde Wildschweine auf einem Kindergeburtstag vor Neid erblassen ließe. Besonders in unseren geliebten Ozeanen, die wir als globale Müllkippe und chemisches Versuchslabor missbraucht haben. Die große Frage, die uns heute umtreibt wie ein führerloses Geisterschiff (und wahrscheinlich auch die Fische, wenn sie denn philosophische Anwandlungen hätten):
Wie lange, verdammt nochmal, braucht der große blaue Teich, um sich von unserer ausschweifenden, jahrtausendelangen Party-Orgie zu erholen?
Vorab sei gesagt, und das ist keine Überraschung: Die Antwort ist komplexer als die Steuererklärung eines Oktopus mit acht verschiedenen Einkommensquellen. Es gibt nicht DIE eine Zahl, die wir dir wie eine magische Losnummer präsentieren können. Es ist eher wie bei der Renovierung einer völlig verdreckten Studenten-WG nach einer legendär eskalativen Abschlussparty – manche Flecken, wie der verschüttete Pfefferminztee, gehen schnell raus, andere, wie das eingebrannte Chili-con-Carne-Kunstwerk auf dem Ceranfeld oder der undefinierbare Fleck hinter dem Sofa, nun ja, die bleiben für die Ewigkeit (oder zumindest gefühlt so lange). Aber weil wir Zahlen lieben und du, unser geschätzter und leicht masochistischer Leser, Fakten willst, auch wenn sie so absurd sind, dass sie schon wieder genial sind: Die Wissenschaft, in ihren lichten Momenten zwischen Verzweiflung und Galgenhumor, munkelt, dass die vollständige chemische Entgiftungskur des Ozeans von unserem CO2-Rausch und dem ganzen anderen Müll sich über geologische Zeiträume hinzieht. Wenn man den aller-aller-allerlangsamsten, aber global wirksamen Prozess als Maßstab nimmt – die Verwitterung von Silikatgestein, die CO2 aus der Atmosphäre zieht und so die Ozeanversauerung umkehrt – dann könnte man, mit viel wissenschaftlichem Bauchgefühl, einer Prise stoischer Akzeptanz und einem Augenzwinkern, auf eine Zahl kommen wie ... Trommelwirbel ... 286.411 Jahre! Ja, du hast richtig gelesen. Zweihundertsechsundachtzigtausendvierhundertelf. Eine Zahl so präzise, dass sie schon wieder lachhaft ist, wie die Angabe der Kalorienzahl eines einzelnen Salzkrümelchens. Aber sie gibt uns eine Ahnung von der kosmischen Geduld, die Mutter Natur aufbringen muss, um unseren Mist, den wir über Jahrhunderte angehäuft haben, wieder auszubügeln. Also, tauchen wir ein in die verschiedenen Phasen des planetaren Katers – von der ersten Kopfschmerztablette bis zur vollständigen Ausnüchterung in einer Zukunft, die so fern ist, dass unsere heutigen Sternbilder dann nur noch wirre Strichmännchen sind.
Phase 1: Die Sofort-Erleichterung (Die ersten Stunden bis Jahre – Das Aspirin wirkt, der Lärm ist weg!)
Das Allererste, was passiert, wenn wir Menschen von jetzt auf gleich verschwinden? Stille! Endlich Ruhe im Karton, oder besser gesagt, im Ozean! Stell dir vor, die Meere atmen kollektiv auf, ein gigantischer Seufzer, der die Wellen sanft kräuselt. Kein nerviges Schiffsmotoren-Gedröhne mehr, das tieffrequent über Hunderte von Kilometern durchs Wasser schallt und die Kommunikation der Meeresbewohner stört.
Wissenschaftler schätzen, dass der von Menschen verursachte Unterwasserlärmpegel in einigen Gebieten seit Beginn der Industrialisierung um das Zehnfache oder mehr gestiegen ist.
Dieses ständige Brummen, Hämmern und Quietschen, das für viele Meereslebewesen Stress pur bedeutet, wäre quasi über Nacht weg. Kein militärisches Sonar-Ping-Pong mehr, das Wale zur panischen Flucht treibt und manchmal sogar zu tödlichen Strandungen führt. Keine scheppernden Ölbohrplattformen, die wie rostige Riesen im Meer stehen und rund um die Uhr Lärm produzieren.
Die Wale können endlich wieder ungestört ihre neuesten Balladen trällern, ihre komplexen Gesänge über Tausende von Kilometern schicken, ohne von einem Containerschiff der Panamax-Klasse übertönt zu werden. Die Delfine können tuscheln, klatschen und ihre neuesten Ultraschall-Witze erzählen, ohne dass eine Armada von Freizeitbooten ihre Konversation stört. Das ist quasi der "Kopfhörer runter, Welt an"-Moment für rund 70% unseres blauen Planeten. Diese akustische Wohltat tritt quasi sofort ein, denn Schall breitet sich im Wasser etwa viereinhalbmal schneller aus als in der Luft. Innerhalb weniger Monate, vielleicht sogar Wochen, würde der Ozean wieder zu einem Ort der entspannten Walgesänge und des leisen Planktonknisterns, statt der industriellen Heavy-Metal-Beschallung, die wir ihm aufgezwungen haben. Das wäre ein Segen, vor allem für Meeressäuger, die auf Schall zur Navigation, Kommunikation und Jagd angewiesen sind.
Gleichzeitig: Party für die Fische! Aber was für eine! Stell dir vor, von einem Tag auf den anderen sind keine fiesen Schleppnetze mehr da, die den Meeresboden umpflügen und alles einsaugen, was nicht bei drei auf den Korallen ist. Keine kilometerlangen Langleinen mit Tausenden tückischen Haken, die wahllos Seevögel, Schildkröten und Haie erwischen. Die Fischbestände, die wir oft bis an den Rand des Kollapses oder darüber hinaus dezimiert haben –
man denke an den Kabeljau vor Neufundland, dessen Bestände in den frühen 90ern zusammenbrachen und sich bis heute kaum erholt haben
– könnten endlich mal durchatmen. Kleine, schnell laichende Fische wie Sardinen, Heringe oder Anchovis (Europäische Sardelle) würden wahrscheinlich innerhalb von ein, zwei Jahrzehnten eine Bevölkerungsexplosion erleben. Sie würden denken: "Wow, ist es hier plötzlich leer und geräumig geworden! Mehr Plankton für uns!" und sich fröhlich vermehren, bis die natürlichen Fressfeinde wieder Überhand gewinnen. Studien zeigen, dass schon ein Moratorium von wenigen Jahren bei bestimmten Arten zu einer deutlichen Erholung führen kann, wenn denn die Umweltbedingungen stimmen.
Auch die direkte Kloake-ins-Meer-Mentalität, die in vielen Teilen der Welt noch immer fröhliche Urständ feiert, endet abrupt. Flussmündungen und Küstenabschnitte, die vorher die Endstation für unsere ungeklärten oder nur notdürftig geklärten Abwässer, Industriechemikalien und den ganzen urbanen Dreck waren, würden sehr schnell merken, dass der tägliche Schmutz-Nachschub ausbleibt. Das Wasser würde dort, wo wir direkt unsere Hinterlassenschaften reingekippt haben, innerhalb von Monaten bis wenigen Jahren deutlich klarer. Seegraswiesen und küstennahe Riffe bekämen wieder mehr Licht. Das ist die Phase, in der die Natur merkt: "Hey, die nervigen, lärmenden Zweibeiner sind weg! Zeit für 'ne gigantische Unterwasser-Polonaise Blankenese!"
Phase 2: Das langsame Aufräumen (Jahrzehnte bis Jahrhunderte – Der Kater ist noch da, aber man kann wieder geradeaus gucken, ohne sich sofort übergeben zu müssen)
Aber halt, mein lieber Tiefsee-Träumer, so schnell geht's dann doch nicht mit der kompletten Wiederherstellung des maritimen Paradieses. Das war nur das Aspirin, das die gröbsten Kopfschmerzen lindert. Die Erholung der großen, langlebigen Fische – Thunfische, die mehrere Jahrzehnte alt werden können, Haie, von denen manche Arten (wie der Grönlandhai) über 400 Jahre alt werden, oder die Methusalems der Tiefsee wie der Granatbarsch, der über 150 Jahre auf dem Buckel haben kann – ist eher ein Marathon als ein Sprint. Diese Arten brauchen viele Jahre, um geschlechtsreif zu werden, und bekommen oft nur wenige Nachkommen. Bis die Ozeane wieder voller stattlicher Opas und Uromas dieser Arten sind und die komplexen Nahrungsnetze sich von unserem industriellen Raubbau und der gezielten Entnahme der Spitzenprädatoren erholt haben, vergehen locker ein paar Jahrhunderte.
Das ist, als würde man versuchen, eine vom Aussterben bedrohte Adelsfamilie, bei der nur noch ein scheintoter Uronkel übrig ist, wieder aufzubauen – das dauert, und man braucht viel Geduld und günstige Umstände.
Es wird geschätzt, dass einige große Walarten nach dem Ende des kommerziellen Walfangs fast ein Jahrhundert gebraucht haben oder noch brauchen werden, um ihre Populationen wieder auf ein halbwegs stabiles Niveau zu heben.
Und erinnerst du dich an die "Todeszonen"? Diese unschönen, sauerstoffarmen (hypoxischen) oder gar sauerstofffreien (anoxischen) Bereiche, die wir durch massive Überdüngung mit Nährstoffen aus industrieller Landwirtschaft (Stickstoff- und Phosphordünger) und unzureichend geklärten kommunalen Abwässern geschaffen haben. Es gibt weltweit über 400 solcher Zonen, die zusammen eine Fläche von mehr als 245.000 Quadratkilometern bedecken – das ist größer als Großbritannien! Selbst wenn wir keinen neuen Dünger mehr reinspülen, haben sich die Altlasten, also die überschüssigen Nährstoffe, gemütlich im Meeresboden eingenistet. Wie ein vollgesogener Schwamm geben sie ihre Nährstoffe nur widerwillig und über Jahrzehnte bis Jahrhunderte wieder an die Wassersäule ab, wo sie weiterhin Algenblüten befeuern, die dann absterben, absinken und am Meeresboden von Bakterien unter Sauerstoffverbrauch zersetzt werden. Es ist, als hätte man Rotwein auf einen dicken, weißen Flokatiteppich gekippt – selbst wenn man nicht mehr nachkippt, der Fleck bleibt erstmal und muss mühsam und über lange Zeit rausgeschrubbt werden, oder besser gesagt, er muss sich langsam abbauen. Bis diese "Todeszonen" wieder zu lebendigen, sauerstoffreichen Meeresbereichen werden, können locker 50 bis 300 Jahre ins Land (oder besser gesagt, ins Meer) ziehen, je nach Tiefe, Strömungsverhältnissen und Menge der eingelagerten Nährstoffe.
Physische Zerstörung ist auch so eine Sache, die uns noch lange erhalten bleibt. Die Korallenriffe, unsere "Regenwälder der Meere", die wir mit Dynamitfischerei pulverisiert, mit Schleppnetzen planiert oder durch die von uns verursachte Erwärmung und Versauerung gebleicht und abgetötet haben, wachsen langsamer als ein Faultier im Winterschlaf auf Valium. Korallen wachsen im Schnitt nur wenige Millimeter bis Zentimeter pro Jahr. Bis ein komplexes, artenreiches Riff-Ökosystem wieder vollständig aufgebaut ist, nachdem es zerstört wurde, braucht es Jahrhunderte bis Jahrtausende – und das auch nur, wenn die Bedingungen (Temperatur, Wasserqualität, pH-Wert) wieder optimal sind, was angesichts des Klimawandels eine sehr optimistische Annahme ist. Unsere Betonmonster an den Küsten – Hafenmauern, Molen, Wellenbrecher, künstliche Inseln – werden zwar irgendwann von der unermüdlichen Kraft der Wellen und der chemischen Verwitterung zernagt und erodiert, aber das dauert ebenfalls Äonen. Stahlbeton in Meerwasser hat eine geschätzte Lebensdauer von vielleicht 50 - 100 Jahren, bis er ernsthaft bröckelt, aber massive Strukturen bleiben als künstliche Felsen für viele Jahrhunderte bis Jahrtausende bestehen. Die Narben der Schleppnetzfischerei in der Tiefsee, wo die Sedimentationsraten extrem gering sind (oft nur Millimeter pro Jahrtausend)?
Die bleiben sichtbar, als hätte jemand mit einem riesigen Pflug durch Omas gepflegten Vorgarten geackert – für Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende, weil da unten in der lichtlosen, kalten Tiefe einfach so gut wie nichts passiert, um diese Spuren zu verwischen.
Phase 3: Die hartnäckigen Altlasten (Jahrhunderte bis viele Jahrtausende – Der Moment, wo man merkt, dass der verdammte Fleck auf dem Teppich doch nicht rausgeht, egal wie oft man schrubbt)
Jetzt kommen wir zu den Dingen, die wirklich, WIRKLICH lange bleiben und uns als Menschheit ein unrühmliches Denkmal setzen. Unsere chemischen Cocktails zum Beispiel, die wir großzügig in die Umwelt entlassen haben. Schwermetalle wie Quecksilber (aus Kohleverbrennung, Goldabbau), Blei (aus Benzin, Farben, Batterien) oder Cadmium (aus Batterien, Düngemitteln) sind die ultimativen Stehaufmännchen der Umweltverschmutzung – die gehen nicht einfach weg, die bauen sich nicht biologisch ab. Sie sind Elemente, sie bleiben. Die lagern sich im Sediment ab, werden dort vielleicht von Bakterien in noch giftigere organische Verbindungen umgewandelt (wie Methylquecksilber) oder reichern sich in der Nahrungskette an (Biomagnifikation), bis irgendwann ein unglücklicher Eisbär oder ein Tiefseefisch die gesammelten Sünden einer ganzen Industrienation in seinem Fettgewebe und seinen Organen trägt. Die Konzentrationen dieser Schwermetalle in der Wassersäule und in den oberen Sedimentschichten sinken nur extrem langsam durch geologische Prozesse wie die Einlagerung in tiefere, inaktive Sedimentschichten oder durch Verdünnung über riesige Wassermassen – das dauert viele Jahrhunderte bis Zehntausende von Jahren.
Dann die berüchtigten POPs – Persistente Organische Schadstoffe. Klingt fast harmlos, wie eine neue Popband, sind aber fiese, langlebige Chemikalien (DDT, PCBs, Dioxine, Furane, per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, kurz PFAS, etc.), die wir für alles Mögliche designt haben, von Insektiziden über Flammschutzmittel bis hin zu Teflonpfannen. Das Problem: Sie sind oft fettlöslich (lipophil), reichern sich daher im Fettgewebe von Lebewesen an, und sind extrem stabil, also schwer abbaubar. Und sie reisen um die Welt wie unliebsame Touristen, die niemand eingeladen hat, durch atmosphärischen Transport und Meeresströmungen, und konzentrieren sich oft in kalten Regionen wie der Arktis ("global distillation"). Der Abbau dieser Substanzen, besonders in der kalten, lichtlosen Tiefsee, wo die mikrobielle Aktivität gering ist, dauert ewig. Wir reden hier von Halbwertszeiten, die von Jahren bis zu vielen Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten reichen können. Bis die Konzentrationen auf ein unbedenkliches Niveau gesunken sind, können wieder Jahrhunderte bis viele Jahrtausende vergehen.
Das ist der chemische Kater, der einfach nicht verschwinden will, egal wie viele grüne Smoothies Mutter Natur trinkt.
Und natürlich: Plastik! Unser glorioser Exportschlager des 20. und 21. Jahrhunderts, den wir in die Ozeane verfrachtet haben, als gäbe es kein Morgen. Schätzungen zufolge landen jedes Jahr zwischen 4,8 und 12,7 Millionen Tonnen Plastikmüll in den Meeren (eine Zahl von Jambeck et al. aus 2015, die immer noch oft zitiert wird, obwohl aktuellere Schätzungen eher von noch mehr ausgehen). Der unkaputtbare Müll. Große Teile wie Flaschen, Tüten und Fischernetze zerfallen zwar über Jahrzehnte durch UV-Strahlung und mechanische Einwirkung (Wellen, Abrieb) zu immer kleineren Teilchen – dem berüchtigten Mikroplastik (kleiner als 5 mm) und schließlich Nanoplastik (kleiner als 100 nm). Das ist quasi Umwelt-Glitter, der überall ist, von der Wasseroberfläche bis in die tiefsten Tiefseegräben, und der von Plankton bis zu Walen aufgenommen wird. Aber das Mikro- und Nanoplastik selbst? Dessen vollständiger Abbau zu CO2 und Wasser dauert ... tja, da streiten sich die Gelehrten noch, denn das hängt stark von der Art des Polymers, den Umweltbedingungen und den beteiligten Mikroorganismen ab. Für eine PET-Flasche werden Abbauzeiten von etwa 450 Jahren genannt, für Fischernetze aus Nylon bis zu 600 Jahre. Aber das sind Schätzungen für den Zerfall in kleinere Stücke, nicht für die komplette Mineralisierung.
Plastik ist der ungeladene, besoffene Gast auf der Erholungsparty des Ozeans, der einfach nicht gehen will, sich überall breitmacht und die Playlist kapert, von der sonnendurchfluteten Oberfläche bis in die exklusive Marianengraben-VIP-Lounge.
Bis der letzte Joghurtbecher und die letzte Mikroplastikfaser zerfallen sind, sind wahrscheinlich schon neue Kontinente durch Plattentektonik entstanden und wieder erodiert. Mindestens 500 bis 10.000+ Jahre Plastik-Party-Reste. Prost Mahlzeit! Und das ist nur das sichtbare Problem; die chemischen Additive, die aus dem Plastik auslaugen (Weichmacher, Flammschutzmittel etc.), sind ein weiteres langlebiges Gift-Kapitel für sich.
Phase 4: Die Jahrhundert-Wunde (Zehntausende bis Hunderttausende von Jahren – Der Kater, der Generationen überdauert und eine komplette Lebenumstellung und Entgiftungskur des Planeten erfordert)
Okay, festhalten, mein Freund des feuchten Elements, jetzt wird's wirklich absurd langsam und wir verlassen den Bereich menschlicher Vorstellungskraft. Selbst wenn all der physische Müll und der meiste chemische Dreck irgendwann weg ist oder tief im Sediment vergraben schlummert, bleibt das größte, fundamentalste Problem: Wir haben am globalen Thermostat gedreht und die grundlegende Chemie der Ozeane über den Haufen geworfen wie ein trotziges Kind sein Spielzeug. Stichworte: Klimawandel und Ozeanversauerung. Das sind die Langzeitfolgen unserer CO2-Party.
Die Ozeane haben bisher, wie ein riesiger, gutmütiger Schwamm, brav einen Großteil unserer überschüssigen Wärme geschluckt – über 90% der zusätzlichen Wärmeenergie, die durch den von Menschen verursachten Treibhauseffekt im Erdsystem gefangen ist, wurde von den Ozeanen aufgenommen. Das ist eine unvorstellbare Energiemenge, die das Wasser erwärmt hat, besonders in den oberen Schichten. Aber diese Wärme ist jetzt drin.
Und die Ozeane sind thermisch träge wie ein Beamter kurz vor der wohlverdienten Pensionierung.
Es dauert Jahrtausende, bis diese zusätzliche Wärme durch komplexe Austauschprozesse mit der Atmosphäre und dem Weltraum wieder abgestrahlt ist. Selbst wenn wir morgen aufhören würden, CO2 zu emittieren (oder eben, weil wir puff weg sind), würde sich der Ozean noch für Jahrhunderte bis Jahrtausende weiter erwärmen, da die Tiefsee nur sehr langsam auf die Erwärmung der Oberfläche reagiert. In der Zwischenzeit? Steigender Meeresspiegel allein durch thermische Ausdehnung (warmes Wasser braucht mehr Platz), veränderte Meeresströmungen (der Golfstrom könnte husten oder sich verschlucken), intensivere Wirbelstürme, gestresste Korallen, wandernde Fischbestände – das volle Programm, auch ohne uns als direkte Verursacher neuer Emissionen.
Und die Versauerung! Wir haben seit der industriellen Revolution so viel Kohlendioxid (CO2) in die Atmosphäre gepustet (aktuell über 420 ppm, vorindustriell waren es ca. 280 ppm), dass die Ozeane etwa ein Viertel bis ein Drittel davon absorbiert haben. Das hat zwar den Klimawandel an Land etwas gebremst, aber im Wasser hat es zu einer chemischen Reaktion geführt: CO2 löst sich in Wasser zu Kohlensäure, die dann zerfällt und Protonen (H+-Ionen) freisetzt. Mehr Protonen bedeuten einen niedrigeren pH-Wert, das Wasser wird saurer. Der durchschnittliche pH-Wert der Meeresoberfläche ist bereits von ca. 8,2 auf 8,1 gesunken. Das klingt nach wenig, ist aber auf der logarithmischen pH-Skala ein Anstieg der Protonenkonzentration um etwa 30%.
Die Ozeane sind also sauer geworden wie eine Zitrone auf Speed, oder zumindest wie ein Mineralwasser mit zu viel Kohlensäure.
Das ist extrem schlecht für alles, was Kalkschalen oder -skelette aus Kalziumkarbonat baut – Korallen, Muscheln, Schnecken, Seeigel, aber auch winzige Plankton-Organismen wie Foraminiferen und Pteropoden (Meeresschmetterlinge), die eine entscheidende Basis für viele marine Nahrungsnetze sind. Die kriegen quasi Sodbrennen im großen Stil, ihre Schalen lösen sich leichter auf oder können gar nicht erst richtig gebildet werden.
Und wie lange dauert es, bis der Ozean seinen pH-Wert wieder im Griff hat und das überschüssige CO2 aus dem Ozean-Atmosphären-System entfernt ist? Jetzt kommen die wirklich großen Zahlen ins Spiel, die Zahlen, bei denen selbst Geologen anfangen, unruhig auf ihren Stühlen hin und her zu rutschen. Die Natur hat dafür im Wesentlichen zwei Hauptmethoden, beide quälend langsam und auf geologischen Zeitskalen operierend:
Ozeanische Rennie-Tabletten (Karbonat-Kompensation): Über Tausende von Jahren (man rechnet hier mit Zeiträumen von ca. 1.000 bis 10.000 Jahren) löst das saurer gewordene Wasser Kalk (Kalziumkarbonat, CaCO3) vom Meeresboden auf, insbesondere in größeren Tiefen. Dieser Prozess neutralisiert einen Teil der Säure und hilft, CO2 zu binden. Das ist aber quasi nur eine Symptombekämpfung und kann nur einen Teil des Problems lösen, bevor das leicht lösliche Karbonat aufgebraucht ist.
Geologische Gesteinswäsche (Silikat-Verwitterung): Der ultimative und langsamste Weg, um CO2 langfristig aus dem Atmosphären-Ozean-System zu entfernen, ist die Verwitterung von Silikatgestein an Land. Regen, der CO2 aus der Atmosphäre aufgenommen hat und dadurch leicht sauer ist (Kohlensäure), wäscht Mineralien (wie Kalzium- und Magnesiumsilikate) aus den Gesteinen. Diese gelösten Mineralien werden über Flüsse ins Meer transportiert. Dort reagieren sie letztendlich so, dass das CO2 als Karbonat-Ionen gebunden und schließlich als Kalziumkarbonat (z.B. in den Schalen von Meeresorganismen) ausgefällt und im Sediment eingelagert wird. Dieser Prozess ist unglaublich langsam und hängt von vielen Faktoren ab (Temperatur, Niederschlag, Art des Gesteins, Vegetation). Wie lange dauert das? Zehntausende bis Hunderttausende von Jahren.
Hier kommen wir zurück zu unserer aberwitzig präzisen Zahl, die wir dir am Anfang genannt haben: Die Wissenschaft, die sich mit diesen ultralangsamen Kohlenstoffzyklen beschäftigt – Koryphäen wie der Ozeanograph David Archer von der University of Chicago oder die umfangreichen Berichte des IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) – legt nahe, dass es mindestens 100.000 Jahre, vielleicht sogar 200.000 bis 400.000 Jahre dauert, bis der allergrößte Teil eines massiven CO2-Pulses, wie wir ihn gerade verursachen, durch diese natürlichen Prozesse wieder aus dem System entfernt ist und die Ozeanchemie sich normalisiert hat. Unsere Zahl, die 286.411 Jahre, ist eine Art humorvolle, aber gleichzeitig erschreckend konkrete Veranschaulichung dieser unvorstellbaren Zeitspanne. Stell dir das mal vor: Die Menschheit ist längst zu Staub zerfallen, neue Eiszeiten sind gekommen und wieder gegangen, die Kontinente haben sich merklich verschoben (Afrika könnte schon ordentlich an Europa geknabbert haben), vielleicht haben sich sogar neue intelligente Spezies entwickelt – und der Ozean ist immer noch dabei, unseren CO2-Rausch auszugleichen und die letzten Reste unserer globalen Party-Kohlensäure aufzustoßen.
Das ist der ultimative planetare Kater, der so lange andauert, dass selbst die Sterne am Himmel eine andere Konstellation haben werden.
Phase 5: Die ewigen Narben (Für immer und drei Tage – Der Schaden, den selbst die geologische Zeit nicht oder nur extrem langsam heilt)
Man sollte meinen, nach ein paar hunderttausend Jahren wäre der Spuk dann aber wirklich vorbei. Aber selbst diese unfassbar langen Zeiträume sind nicht das Ende der Geschichte für einige unserer Hinterlassenschaften. Da wären zum Beispiel noch die Fässer mit radioaktivem Müll, die wir, in unserer unendlichen Weisheit, irgendwo in den Tiefen der Ozeane versenkt haben (z.B. im Nordostatlantik). Auch wenn die Behälter irgendwann korrodieren und undicht werden, die radioaktiven Isotope darin haben teilweise extrem lange Halbwertszeiten. Plutonium-239 zum Beispiel, ein Bestandteil von Atombomben und Brennstäben, hat eine Halbwertszeit von 24.110 Jahren. Iod-129, ein Spaltprodukt aus Kernreaktoren, hat eine Halbwertszeit von 15,7 Millionen Jahren! Und Technetium-99 211.100 Jahre. Diese strahlenden Hotspots bleiben als unsere leuchtenden, wenn auch unsichtbaren Visitenkarten für geologische Ewigkeiten bestehen, und könnten lokale Ökosysteme für Zeiträume belasten, die jede menschliche Vorstellungskraft sprengen.
Und dann ist da noch das vielleicht traurigste Kapitel unserer Party-Exzesse: Aussterben. Die Arten, die wir direkt oder indirekt auf dem Gewissen haben – durch Überjagung (wie den Beutelwolf oder die Stellersche Seekuh), Lebensraumzerstörung (unzählige Amphibien-, Insekten- und Korallenarten) oder die rasanten Veränderungen durch den Klimawandel, an die sich viele Arten nicht schnell genug anpassen können – die kommen nicht zurück. Nie wieder.
Das ist, als würde man ein unersetzliches Kunstwerk von Leonardo da Vinci oder eine Originalpartitur von Mozart nicht nur verbrennen, sondern atomisieren.
Die Evolution wird weitergehen, ja. Neue Nischen werden frei, und im Laufe von Millionen von Jahren werden sich neue Arten entwickeln, die diese Nischen füllen. Aber die spezifischen Arten, die wir ausgelöscht haben, mit ihrer einzigartigen genetischen Ausstattung und ihrer eigenen Evolutionsgeschichte, sind für immer verloren. Das ist die eine Party-Sauerei, die niemand jemals wieder aufräumen kann, nicht einmal Mutter Natur mit all ihrer unendlichen Geduld. Die aktuelle Aussterberate, angetrieben durch menschliche Aktivitäten, wird auf das 100- bis 1000-fache der natürlichen Hintergrund-Aussterberate geschätzt. Das hinterlässt Lücken im Gewebe des Lebens, die für immer klaffen werden.
Fazit: Lachen, um nicht zu weinen, oder wie war das mit der Polonaise?
Unser kleiner, zugegebenermaßen etwas makaber-humoristischer Ausflug in eine hypothetische Zukunft ohne uns zeigt eines ganz deutlich: Die Ozeane sind unglaublich zäh und widerstandsfähig, aber wir haben ihnen Wunden zugefügt, die auf Zeitskalen heilen, die jeden menschlichen Horizont und jede Netflix-Serienmarathon-Länge bei weitem sprengen. Der Lärm ist schnell weg? Ja, ein paar Tage bis Monate, und die Wale können wieder ungestört plaudern. Die Fischbestände erholen sich? Dauert schon ein paar Generationen (von Fischen, also Jahrzehnte bis Jahrhunderte für viele Arten), wenn die Bedingungen denn stimmen. Der Plastikmüll ist weg? Vielleicht in ein paar Jahrtausenden, wenn wir Glück haben und die Bakterien einen Zahn zulegen, aber die chemischen Zusätze geistern noch länger herum. Aber der CO2-Kater und die Ozeanversauerung?
Der dauert Hunderttausende von Jahren, symbolisiert durch unsere fast schon dadaistisch anmutende, aber wissenschaftlich nicht ganz aus der Luft gegriffene Zahl von 286.411 Jahren.
Was lernen wir daraus, außer dass die Zahl 286.411 eine merkwürdige Faszination ausübt? Vielleicht, dass wir die Party nicht ganz so exzessiv hätten feiern sollen, dass wir vielleicht nicht jeden Drink hätten exen und nicht jede Kippe auf den Teppich hätten schnippen sollen. Und dass es, wenn wir schon nicht puff machen und verschwinden wollen (was ja auch irgendwie schade wäre, trotz allem), höchste Zeit ist, mit dem Aufräumen anzufangen, BEVOR wir endgültig den Abgang machen oder der Planet uns vor die Tür setzt. Denn ganz ehrlich: Wer will schon eine Viertelmillion Jahre oder länger warten, bis der Planet und seine Ozeane wieder klarkommen und der letzte Rest unserer Sünden getilgt ist?
Also, lieber Meeresfreund, packen wir's an – Emissionen runter, als gäbe es kein Morgen (denn sonst gibt es vielleicht wirklich keinen, der lebenswert ist), Müll raus aus den Meeren und vor allem gar nicht erst rein, Riffe schützen und wiederaufbauen, nachhaltige Fischerei etablieren, und generell ein bisschen mehr Demut vor dem blauen Wunder zeigen, das mehr als zwei Drittel unseres Planeten bedeckt. Es ist zwar nicht ganz so lustig und abgedreht wie unser Gedankenexperiment heute, aber definitiv besser für alle Beteiligten – für uns, für die, die nach uns kommen (sofern es welche gibt), und ganz besonders für die Fische. Die können dann nämlich wirklich ungestört und ohne Sorgenfalten auf der Stirn ihre Polonaise durch saubere, gesunde und nicht übersäuerte Ozeane tanzen. Und das wäre doch ein Happy End, das selbst Hollywood nicht besser schreiben könnte, oder?
Bleib sauber!
Bitte bedenke, dass dieser Artikel zwar rein fiktiv ist und nur hypothetische Annahmen darstellt, aber dennoch reale Tatsachen beinhalten und/oder von solchen inspiriert sein kann.
Klartext braucht eine starke Crew.
The Ocean Tribune ist zu 100% unabhängig, werbefrei und für alle frei zugänglich. Wir lassen uns von keiner Lobby kaufen, weil wir nur einer Sache verpflichtet sind: dem Ozean.
Das ist nur möglich, weil eine Crew von unerschrockenen Unterstützern hinter uns steht, die diesen Kurs finanziert. Wenn du unsere Arbeit wertvoll findest, dann werde jetzt Teil dieser Bewegung. Jeder Beitrag ist Treibstoff für unsere Mission und sorgt dafür, dass wir weiter die unbequemen Wahrheiten aussprechen können.
Aus der Werkstatt: Vom Problem zur Lösung
Aufklärung ist der erste Schritt. Die Umsetzung der zweite. Wir bei Vita Loom Labs entwickeln die professionellen Werkzeuge und strategischen Prozesse, die Impact-Organisationen dabei helfen, ihre Missionen wirkungsvoller zu machen.
Sie wollen sehen, wie unser strategischer Prozess in der Praxis aussieht? Unsere 'Blueprint Case Study' demonstriert Schritt für Schritt, wie wir aus einer guten Idee einen unwiderstehlichen, förderfähigen Antrag schmieden.
The Ocean Tribune
Wir wissen, was die Ozeane zu sagen haben!