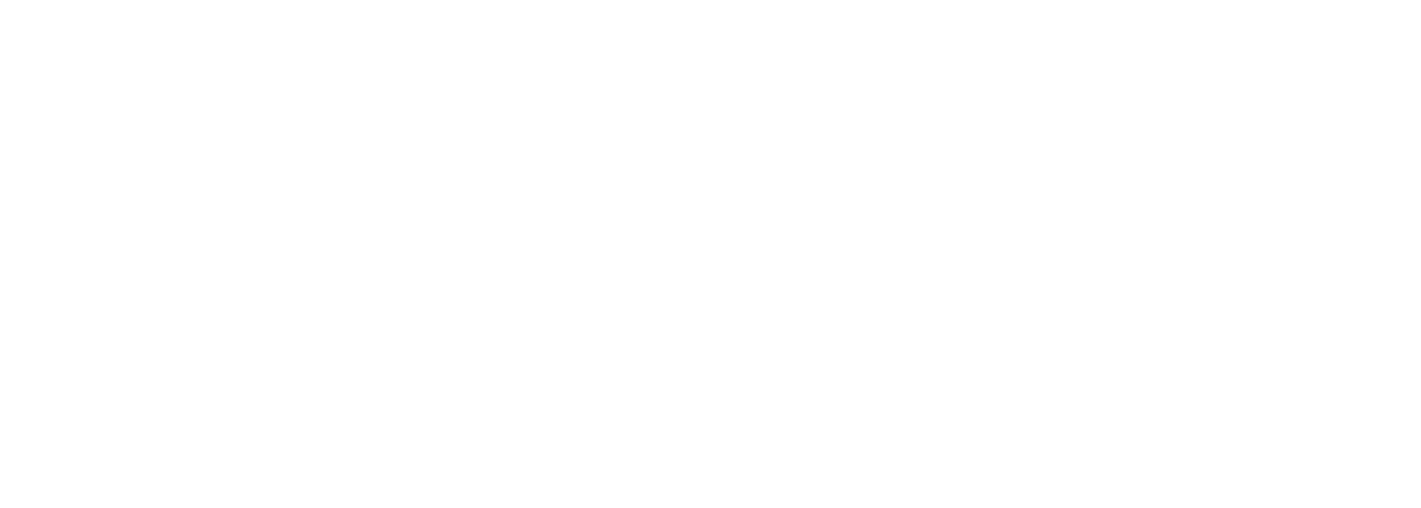Rotes Wasser, stumme Schreie: Warum der Kampf gegen die Walmörder (Grindadráp) auf den Färöern ein neues Schwert braucht
- Patricia Plunder
- 21. Juli 2025
- 6 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 6. Aug. 2025

Von Patricia Plunder
Ich habe wieder diese Bilder gesehen. Du weißt, welche ich meine. Die Bilder, die sich wie ein rostiger Anker in dein Gedächtnis bohren und dich nachts wachhalten. Das blutrote Wasser in einer Bucht, so rot, als hätte der Ozean selbst eine tödliche Wunde erlitten. Die glatten, grauen Leiber von Dutzenden von Grindwalen, aufgerissen, leblos aneinandergereiht am Kai. Und dazwischen die Menschen. Lachend, schleifend, messerwetzend.
Das Grindadráp. Ein Wort, das klingt wie ein Kehlkopf-Rasseln kurz vor dem Tod.
Jedes Mal, wenn ich diese Bilder sehe, durchlaufe ich dieselben drei Phasen. Zuerst die pure, weiße Wut. Eine Wut so heiß, dass sie das Meerwasser um mich herum zum Kochen bringen könnte. Ich will schreien, ich will etwas zertrümmern, ich will ein Schiff kapern und Kurs auf Tórshavn setzen.
Dann kommt die tiefe, schwarze Trauer. Ich denke an diese hochintelligenten, sozialen Tiere. Familien, die seit Generationen durch die kalten Weiten des Atlantiks ziehen. Ich stelle mir ihre Panik vor, die Schreie, die sie unter Wasser ausstoßen, die wir aber nicht hören können. Ein stummes Massaker.
Und dann, nach der Wut und der Trauer, kommt die eine, zermürbende Frage, die mich am meisten quält und die ich heute an dich weiterreiche, mein Freund in dieser digitalen Hafenkneipe: Wie zur verdammten Hölle kann das im 21. Jahrhundert, in einem reichen, europäischen Land, noch verdammt noch mal passieren?
Der Mythos der Tradition und die kalte Realität
Bevor du mir jetzt mit dem ausgelutschten "Aber das ist doch Tradition!"-Argument kommst, lass uns mal kurz die Segel dieses Mythos einholen und sehen, wie morsch das Holz darunter ist. Ja, die Färinger jagen Grindwale seit Jahrhunderten. Damals, in einer Zeit ohne Supermärkte und globalen Handel, war es vielleicht eine Notwendigkeit, um über die harten Winter zu kommen. Ein brutaler, aber notwendiger Teil des Überlebens.
Aber wir leben nicht mehr im 10. Jahrhundert. Die Färöer-Inseln sind heute eine moderne, subventionierte High-Tech-Gesellschaft mit einer der höchsten BIP-pro-Kopf-Raten der Welt. Sie haben volle Supermärkte, Glasfaserkabel und Geländewagen. Die Notwendigkeit ist verschwunden. Was geblieben ist, ist ein blutiges Volksfest. Ein Ritualmord als Teambuilding-Event.
Und es wird noch schlimmer. Die Wissenschaft, die wir ja so gerne ignorieren, wenn sie unbequem ist, schreit uns die Fakten ins Gesicht. Eine Langzeitstudie, veröffentlicht unter anderem von Wissenschaftlern wie Pál Weihe, einem Chefarzt des färöischen Gesundheitssystems, hat bereits vor Jahren nachgewiesen, dass Grindwalfleisch hochgradig mit Schadstoffen wie Quecksilber und PCBs verseucht ist. Die Gesundheitsbehörden der Inseln raten selbst vom übermäßigen Verzehr ab, weil es nachweislich die neurologische Entwicklung von Kindern schädigt.
Sie töten also nicht nur Wale, sie vergiften auch langsam ihre eigenen Kinder. Alles im Namen der "Tradition".
Das ist keine Tradition mehr, das ist eine kollektive Wahnvorstellung.
Die Welt schaut zu. Seit den 80er Jahren kämpfen Organisationen wie Sea Shepherd mit unglaublichem Mut gegen diese Praxis. Sie stellen sich mit ihren Schiffen dazwischen, sie dokumentieren, sie klären auf. Sie werden verhaftet, ihre Schiffe beschlagnahmt. Und ja, sie haben Erfolge erzielt. Sie haben die Weltöffentlichkeit auf das Thema gestoßen. Ohne sie wüssten die meisten von uns gar nichts von diesem roten Wasser.
Aber seien wir ehrlich zu uns selbst. Das Gemetzel geht weiter. Warum? Warum scheitern all diese mutigen, passionierten Anläufe daran, dieses blutige Schauspiel endgültig zu beenden?
Weil Wut, Leidenschaft und ein Schlauchboot allein nicht ausreichen, um eine jahrhundertealte Mauer aus Sturheit, Nationalstolz und wirtschaftlichen Interessen einzureißen.

Warum Kampagnen ausbluten (und Traditionen nicht)
Der Kampf gegen das Grindadráp ist ein brutales Abnutzungsrennen. Auf der einen Seite steht die "Tradition", die tief im sozialen Gefüge der Inseln verankert ist. Sie braucht kein Budget. Sie braucht keine Spendenkampagne. Sie ist einfach da, Jahr für Jahr.
Auf der anderen Seite stehen die Kampagnen der Tierschützer. Und diese Kampagnen haben eine Achillesferse: Sie bluten aus.
Eine einzige Saison vor Ort auf den Färöern ist ein logistischer und finanzieller Alptraum. Schiffe, Treibstoff, Crew, Rechtsanwälte, Kameras, Drohnen – das kostet Hunderttausende, wenn nicht Millionen. Dieses Geld muss jedes Jahr aufs Neue durch Spenden gesammelt werden. Und Spenden sind so unbeständig wie das Wetter im Nordatlantik. Sie kommen, wenn die Bilder schrecklich sind und die Medien berichten. Wenn die Kameras weiterziehen, trocknen die Spendenströme aus.
Die Organisationen sind gefangen in einem Teufelskreis. Sie müssen jedes Jahr aufs Neue mit dramatischen Bildern um Aufmerksamkeit und Geld betteln, nur um die nächste Saison zu überleben. Sie können kaum langfristig planen. Sie sind im ständigen Reaktionsmodus.
Der Kampf um die Ozeane wird oft nicht auf dem Wasser verloren, sondern in den Excel-Tabellen und den leeren Bankkonten an Land.
Wir schicken unsere besten Kämpfer in eine jahrelange Belagerung, aber geben ihnen nur Proviant für eine Woche.
Genau das ist die strategische Schwäche. Es fehlt der lange Atem. Es fehlt die finanzielle Grundlage, die es erlaubt, über die nächste Protestaktion hinauszudenken. Es fehlt die Professionalität, nicht im Aktivismus, sondern in der strategischen Organisation im Hintergrund. Die Fähigkeit, große, mehrjährige Förderungen von Stiftungen oder Institutionen zu akquirieren, die nicht auf den schnellen Medien-Hype, sondern auf langfristige, systemische Veränderung setzen.
Die meisten Aktivisten sind keine Finanzexperten oder Antrags-Profis. Und das sollen sie auch gar nicht sein! Ihre Aufgabe ist es, an der Front zu sein. Aber solange ihnen im Hintergrund eine professionelle, strategische Finanz-Maschinerie fehlt, kämpfen sie einen ungleichen Kampf.

Wir schmieden das Schwert. Andere führen es.
Und genau hier, an diesem Punkt der Frustration und der strategischen Analyse, mussten wir bei The Ocean Tribune eine Entscheidung treffen. Wollen wir weiter nur die wütende Möwe sein, die vom Mast aus das Gemetzel kommentiert? Oder wollen wir endlich in den Maschinenraum gehen und anfangen, die Waffen zu schmieden, die diesen Kampf entscheiden könnten?
Wir haben uns für Letzteres entschieden.
Wir werden niemals ein Schiff zu den Färöern schicken. Das ist nicht unser Job. Aber wir können etwas tun, was vielleicht noch wichtiger ist. Wir können dafür sorgen, dass die, die die Schiffe haben, diese auch noch in fünf Jahren betanken können.
Deshalb haben wir das Vita Loom Impact Fellowship geschaffen.
Das ist keine weitere NGO, die um Spenden bettelt. Es ist eine strategische Einheit, eine Werft für die besten Ideen. Wir identifizieren die Organisationen mit dem größten Mut und dem größten Potenzial, und wir geben ihnen das, was ihnen fehlt: die strategische und prozessuale Feuerkraft, um ihren Kampf auf ein neues Level zu heben. Wir nehmen ihre brillante, aber oft chaotische Energie und gießen sie in die Form eines Antrags, der so überzeugend, so professionell und so strategisch ist, dass er auch die Türen zu den großen, langfristigen Geldtöpfen aufstößt.
Wir stoppen keinen einzigen Walfänger. Aber wir sorgen dafür, dass die Organisationen, die sie stoppen wollen, die Puste, die Professionalität und die Mittel haben, um ihren Kampf über Jahre aufrechtzuerhalten.
Wir sind nicht die Helden. Wir sind die Waffenmeister, die den Helden das verdammt schärfste Schwert in die Hand geben, das sie je hatten.
Hör auf, auf das Blut zu starren. Schau auf die Struktur.
Und du? Was kannst du tun? Es ist einfach, diese Bilder auf Social Media mit einem wütenden Emoji zu teilen. Das ist gut, das schafft Bewusstsein. Aber es ist nicht genug.
Wenn du das nächste Mal spendest oder eine Organisation unterstützt, die gegen das Grindadráp kämpft, frag nicht nur: "Was macht ihr vor Ort?" Frag auch: "Wie lautet eure Strategie für die nächsten drei Jahre? Wie sichert ihr eure Finanzierung, wenn die Kameras weg sind?" Unterstütze die Organisationen, die nicht nur einen Plan für die nächste Protestwelle haben, sondern einen Plan für den Sieg.
Wir müssen aufhören, nur auf das rote Wasser zu starren. Das lähmt uns. Wir müssen anfangen, die unsichtbaren Strukturen dahinter zu verstehen und zu bekämpfen. Die finanzielle Unsicherheit, die strategische Kurzatmigkeit, die administrative Last.
Wenn wir diese Strukturen stärken, wenn wir den Kämpfern den Rücken freihalten und ihnen die besten Werkzeuge geben, die es gibt, dann, und nur dann, haben wir eine echte Chance. Dann wird der Tag kommen, an dem das Wasser in diesen Buchten wieder klar ist. Nicht nur für einen Tag, nicht nur für eine Saison. Sondern für immer.
Klartext braucht eine starke Crew.
The Ocean Tribune ist zu 100% unabhängig, werbefrei und für alle frei zugänglich. Wir lassen uns von keiner Lobby kaufen, weil wir nur einer Sache verpflichtet sind: dem Ozean.
Das ist nur möglich, weil eine Crew von unerschrockenen Unterstützern hinter uns steht, die diesen Kurs finanziert. Wenn du unsere Arbeit wertvoll findest, dann werde jetzt Teil dieser Bewegung. Jeder Beitrag ist Treibstoff für unsere Mission und sorgt dafür, dass wir weiter die unbequemen Wahrheiten aussprechen können.
Aus der Werkstatt: Vom Problem zur Lösung
Aufklärung ist der erste Schritt. Die Umsetzung der zweite. Wir bei Vita Loom Labs entwickeln die professionellen Werkzeuge und strategischen Prozesse, die Impact-Organisationen dabei helfen, ihre Missionen wirkungsvoller zu machen.
Sie wollen sehen, wie unser strategischer Prozess in der Praxis aussieht? Unsere 'Blueprint Case Study' demonstriert Schritt für Schritt, wie wir aus einer guten Idee einen unwiderstehlichen, förderfähigen Antrag schmieden.
The Ocean Tribune
Wir wissen, was die Ozeane zu sagen haben!