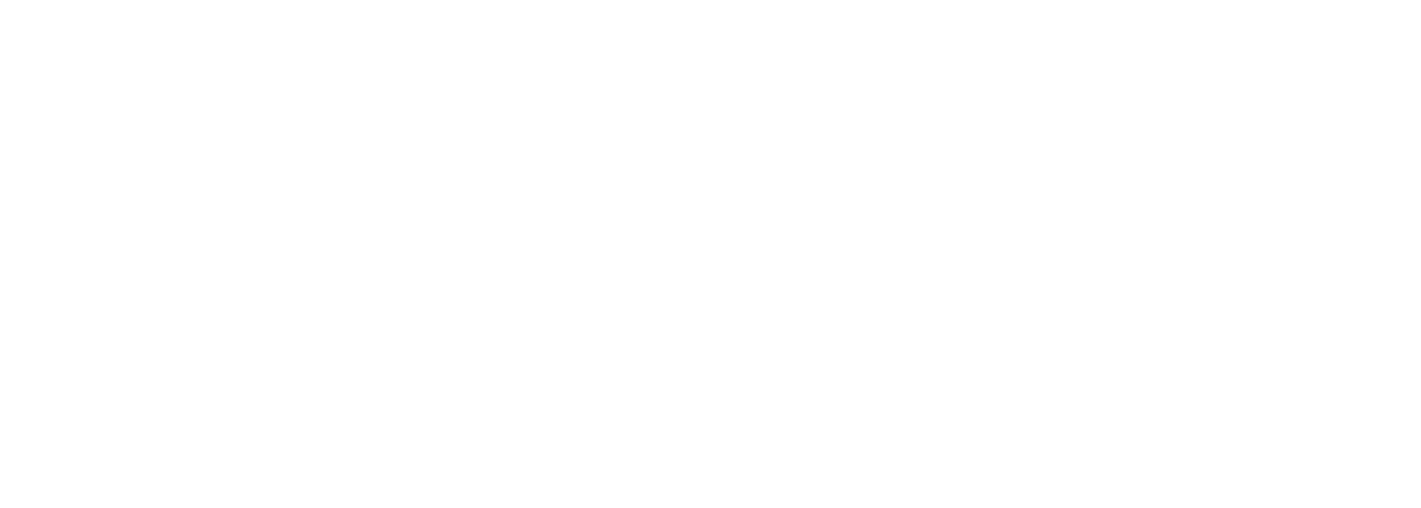Kanonen statt Kiemennetze: Wenn die Marine auf Fisch-Piraten-Jagd geht!
- Doris Divebomber
- 1. Apr. 2025
- 12 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 6. Aug. 2025

Von Doris Divebomber
Okay mein Freund von The Ocean Tribune! Halt dich am Schreibtisch fest, nimm deine Kaffeetasse und setz die (imaginäre) Augenklappe auf, denn wir stechen heute in See zu einem Thema, das weniger nach sanfter Brise und Möwengeschrei klingt, sondern eher nach Enterhaken, Verfolgungsjagden und dem unerwarteten Auftritt schwer bewaffneter Fregatten im Kampf um … Fischstäbchen? Naja, fast. Es geht um den knallharten Kampf gegen die Fisch-Mafia auf hoher See!
Illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischerei – IUU-Fischerei für Eingeweihte, oder wie wir es gerne nennen: der größte organisierte Fischklau seit Erfindung des Netzes – ist eine der absolut fiesesten Plagen, die unsere blauen Ozeane heimsuchen.
Das ist kein kleines Scharmützel unter Anglern, sondern ein globales Verbrechen mit verheerenden Folgen.
Es stiehlt Millionen von Küstenbewohnern ihre Lebensgrundlage, radiert ganze Fischpopulationen aus, als wären sie ein Tippfehler in der Evolution, und destabilisiert ganze Regionen schneller, als man "Aye, Aye, Captain!" sagen kann. Während engagierte Umweltschutzorganisationen sich seit Ewigkeiten die Lungen aus dem Leib schreien und mit immer dramatischeren Bildern warnen (manchmal fragt man sich, ob sie bald auf Walgesang-Sirenen umsteigen), rückt eine eher unerwartete Truppe ins Rampenlicht: die Marinen und Küstenwachen dieser Welt. Ja, genau die, die normalerweise mit U-Booten, Flugzeugträgern und ernsten Gesichtern assoziiert werden. Plötzlich sind sie nicht mehr nur die Wächter der Seewege und nationalen Interessen, sondern auch die letzte, oft verzweifelte Verteidigungslinie gegen eine Schattenindustrie, die mit ihren illegalen Fangmethoden Milliarden scheffelt und dabei die Meeresumwelt wie einen ausgebeuteten Goldrausch-Claim hinterlässt.
Dieser Artikel taucht kopfüber in die raue See der militarisierten Fischereikontrolle ein. Wir beleuchten, wie in den reichen, aber geplünderten Gewässern Westafrikas, in den komplexen Inselwelten Südostasiens und anderswo auf dem Globus der Kampf gegen die Fisch-Piraten mit Kanonenbooten, Drohnen und Satelliten geführt wird. Wir fragen uns, warum diese teuren Einsätze oft so frustrierend erfolglos bleiben, als würde man versuchen, einen Aal mit bloßen Händen zu fangen – und wir feiern auch die Momente, in denen die "Guten" tatsächlich mal einen dicken, illegalen Fisch an Land ziehen. Schnall dich an, das wird eine wilde Fahrt!
Illegale Fischerei: Ein globales Desaster ruft nach … Zerstörern und Korvetten?
Reden wir Tacheles, oder besser: reden wir Tonnen. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), quasi die oberste Buchhaltungsstelle für alles, was im Meer schwimmt und gegessen wird, schätzt, dass jährlich bis zu 26 Millionen Tonnen Fisch auf das Konto dieser IUU-Halunken gehen.
Um das mal greifbar zu machen: Das ist mehr als das Gewicht aller Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen – nur eben in Fisch!
Und dieser gigantische Fischberg hat einen Marktwert von irgendwo zwischen 10 und satten 23,5 Milliarden US-Dollar. Das ist mehr als das jährliche Budget vieler kleinerer Staaten! Mit diesem Geld könnte man vermutlich jedem Seepferdchen ein kleines goldenes Krönchen kaufen.
Die Auswirkungen dieses Raubzugs sind brutal. Besonders hart trifft es Regionen wie Westafrika. Dort pflügen riesige, industrielle Trawlerflotten aus der EU und Asien durch die einst fischreichen Gewässer, als gäbe es einen Preis für den schnellsten ökologischen Kollaps. Das Ergebnis: Über 50 % der dortigen Fischbestände sind bereits überfischt oder zusammengebrochen. Das bedeutet nicht nur leere Teller für Millionen von Menschen, die vom Fischfang leben, sondern auch einen massiven wirtschaftlichen Schaden für die Küstenstaaten. Ihnen entgehen jährlich Milliarden an Lizenzgebühren und Steuereinnahmen, die sie dringend für Schulen, Krankenhäuser oder eben für eine bessere Küstenwache bräuchten. Ein Teufelskreis.
Aber wer soll diese Geisterflotten, diese modernen Kaperfahrer stoppen? Hier liegt der Haken (Wortspiel beabsichtigt). Viele der am stärksten betroffenen Nationen haben schlicht nicht die Mittel. Ihre Küstenwachen bestehen manchmal nur aus einer Handvoll altersschwacher Boote, die kaum seetüchtig sind, und von moderner Satellitentechnologie zur Aufspürung illegaler Trawler können sie oft nur träumen.
Es ist, als wollte man mit einem Fernglas und einem Paddelboot gegen eine Armada von Hightech-Dieben antreten.
Und genau hier springen die Marinen ein. Manchmal tun sie es aus nationalem Sicherheitsinteresse – denn wo illegale Fischerei blüht, sind oft auch Drogenhandel, Waffenschmuggel und Piraterie nicht weit. Manchmal agieren sie aber auch im Auftrag oder mit finanzieller und technischer Unterstützung internationaler Partner (wie der EU oder den USA), die entweder ein schlechtes Gewissen plagt oder die strategische Stabilität in der Region sichern wollen. Es ist eine seltsame Mischung aus Geopolitik, Umweltschutz und der simplen Notwendigkeit, irgendwie Ordnung ins maritime Chaos zu bringen.
Westafrika: Ground Zero im "Krieg um die Sardine"
Die Gewässer vor Westafrika gehören zu den biologisch produktivsten Zonen der Welt – ein echtes Paradies für Meeresleben. Doch genau dieser Reichtum macht sie zum Eldorado für IUU-Fischerei. Die Environmental Justice Foundation (EJF), eine NGO, die sich unermüdlich gegen Umweltverbrechen stemmt, schätzt den jährlichen Schaden durch ausländische Raubfischer in der Region auf unfassbare 2,3 Milliarden US-Dollar. Länder wie Ghana, Senegal oder Liberia sehen sich mit der bitteren Realität konfrontiert, dass ihnen bis zu 37 % ihrer potenziellen legalen Fänge durch die illegalen Netze der Konkurrenz entgehen. Das ist, als würde ein Bauer zusehen müssen, wie Diebe mehr als ein Drittel seiner Ernte vom Feld klauen, bevor er sie selbst einbringen kann.
Die ghanaische Marine beispielsweise führt seit Jahren einen zermürbenden Kampf gegen ein besonders perfides System namens "Saiko". Dabei handelt es sich meist um riesige ausländische Trawler (häufig aus China), die illegal in den küstennahen Zonen fischen, die eigentlich den lokalen Kleinfischern vorbehalten sein sollten. Ihren illegalen Fang – oft wertvolle Arten, die für den Export bestimmt sind – übergeben sie dann heimlich auf hoher See an noch größere Kühlschiffe, sogenannte "Reefer". Diese verschiffen die Ware dann direkt nach Europa oder Asien, ohne jemals einen ghanaischen Hafen anzulaufen.

So werden Kontrollen umgangen, Fangmengen verschleiert und lokale Märkte umgangen.
Ein Bericht aus dem Jahr 2019 malte ein düsteres Bild: Allein in Ghana waren durch diese Praktiken und andere Formen der IUU-Fischerei bereits 90 % der Bestände an kleinen pelagischen Fischen (Sardinen, Sardinellen, Makrelen – die Grundlage der lokalen Ernährung) dezimiert worden. Ein ökologisches und soziales Desaster. Mittlerweile setzt die ghanaische Marine auf moderne Technologie, nutzt Drohnen zur Luftaufklärung und Radarsysteme, um verdächtige Schiffe auch bei Nacht oder schlechtem Wetter zu verfolgen. Finanziert wird dies teilweise durch die EU, die seit 2016 über 50 Millionen Euro in Projekte zur Verbesserung der maritimen Sicherheit in Westafrika investiert hat – eine Art High-Tech-Aufrüstung im Namen des Fischschutzes.
Doch trotz dieser Bemühungen bleiben die Herausforderungen gewaltig. Ein Vorfall im Frühjahr 2022 in Liberia illustriert dies eindrücklich: Die dortige Küstenwache, oft unterbesetzt und unterfinanziert, aber hochmotiviert, konnte einen großen chinesischen Trawler stellen, der mit verbotenen, feinmaschigen Schleppnetzen in einem offiziellen Meeresschutzgebiet operierte. Das Schiff hatte nicht nur illegales Fanggerät an Bord, sondern führte auch gefälschte Lizenzen mit und hatte sein automatisches Identifikationssystem (AIS), das eigentlich zur Ortung dient, manipuliert. Ein Offizier der liberianischen Küstenwache erklärte frustriert (sinngemäß):
„Diese Kapitäne sind absolute Profis im Täuschen und Tricksen. Sie kennen jeden Kniff. Sie löschen ihre elektronischen Fangtagebücher, wechseln die Flagge ihres Schiffes auf See wie andere Leute die Socken oder versuchen, unsere Beamten mit Bargeld zu bestechen.“
Es ist ein ständiges Wettrüsten der Methoden, ein zähes Katz-und-Maus-Spiel auf dem riesigen Spielfeld des Atlantiks, bei dem die "Mäuse" oft über erstaunliche Ressourcen und kriminelle Energie verfügen.
Südostasien: Ein toxischer Cocktail aus Fischdiebstahl, Menschenhandel und Geopolitik
In den komplexen Inselwelten und vielbefahrenen Meeresstraßen Südostasiens nimmt der Kampf gegen IUU-Fischerei noch düsterere Züge an. Hier vermischen sich die illegalen Fangaktivitäten oft nahtlos mit organisierter Kriminalität, Korruption und entsetzlichen Menschenrechtsverletzungen. Die thailändische Marine beispielsweise stieß 2021 auf schockierende Zustände an Bord einiger illegaler Trawler: Die Besatzungen bestanden häufig aus Männern und Jungen aus ärmeren Nachbarländern wie Myanmar oder Kambodscha, die unter falschen Versprechungen an Bord gelockt, ihrer Pässe beraubt und dann unter sklavereiähnlichen Bedingungen zur Arbeit gezwungen wurden. Lange Arbeitszeiten, kaum Lohn, Gewalt und Missbrauch sind an der Tagesordnung. Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) schätzt, dass über 17.000 Menschen in der Fischereiindustrie der Region von solcher Zwangsarbeit betroffen sind.
Hier geht es längst nicht mehr "nur" um den Schutz von Fischbeständen, sondern um die Bekämpfung moderner Sklaverei auf See.
Indonesien, ein riesiger Archipelstaat mit einer immensen Küstenlinie, hat seit 2014 einen besonders drastischen und medienwirksamen Weg eingeschlagen. Die Regierung unter der Führung der resoluten damaligen Fischereiministerin Susi Pudjiastuti ließ über 380 beschlagnahmte ausländische Trawler – meist aus Vietnam, China, Malaysia oder den Philippinen – öffentlichkeitswirksam sprengen und versenken. Ein feuriges Spektakel, das international für Aufsehen sorgte und eine klare Botschaft senden sollte: "Legt euch nicht mit uns an!". Offiziellen Angaben des indonesischen Ministeriums für maritime Angelegenheiten und Fischerei zufolge führte diese "Shock and Awe"-Taktik tatsächlich zu einem dramatischen Rückgang der IUU-Fänge um rund 90 %. Doch die Methode ist umstritten. Kritiker und Umweltschützer warnen vor den langfristigen ökologischen Folgen dieser Praxis. „Jedes versenkte Schiff wird zu einem potenziellen Giftmülldepot am Meeresgrund“, erklärt Ahmad Supriyadi von der indonesischen Umweltorganisation Walhi. „Auslaufendes Öl, giftige Farben, Asbest aus der Isolierung und über die Jahre zerfallendes Mikroplastik können die marinen Ökosysteme nachhaltig schädigen.“ Eine brachiale Lösung mit potenziell hohen ökologischen Kollateralschäden.
Auch in Südostasien spielt technologische Aufrüstung eine immer größere Rolle. Die philippinische Küstenwache beispielsweise nutzt seit 2020 das von den USA bereitgestellte Überwachungssystem "SeaVision". Dieses System integriert Satellitendaten, AIS-Signale und andere Informationsquellen, um ein umfassendes Lagebild der Schifffahrt zu erstellen und verdächtige Aktivitäten schnell zu identifizieren.
Doch gerade im strategisch wichtigen und politisch hochsensiblen Südchinesischen Meer wird deutlich, wie schnell der Kampf gegen illegale Fischerei zum Spielball geopolitischer Interessenkonflikte werden kann.
China beispielsweise setzt seine massive Marine und Küstenwache zwar auch zur Bekämpfung der von ihm so bezeichneten „Fischereipiraten“ ein, nutzt diese Präsenz aber gleichzeitig zur Durchsetzung seiner umstrittenen territorialen Ansprüche gegenüber Nachbarstaaten wie den Philippinen oder Vietnam. Hier verschwimmen die Grenzen zwischen legitimer Rechtsdurchsetzung, Umweltschutz und knallharter Machtpolitik auf bedenkliche Weise.
Militärische Einsätze: Zwischen High-Tech-Hoffnung und ernüchternder Realität

Trotz all der Investitionen in moderne Patrouillenboote, Überwachungsflugzeuge, Drohnen, Satellitentechnologie und internationaler Kooperationsabkommen bleiben die IUU-Netzwerke oft frustrierend schwer zu fassen. Sie scheinen immer einen Schritt voraus zu sein, passen ihre Taktiken an und nutzen jede Schwachstelle im System aus. Woran scheitert es so oft?
Korruption – Der unsichtbare Feind: Es ist ein trauriges, aber weit verbreitetes Phänomen. In vielen Ländern, wie beispielsweise Nigeria oder Guinea-Bissau, erhalten illegale Trawler regelrechte "Persilscheine" von korrupten Beamten oder einflussreichen lokalen Politikern.
Ein Umschlag mit Bargeld (5.000 bis 50.000 US-Dollar pro Schiff sind laut Berichten der Global Initiative Against Transnational Organized Crime keine Seltenheit) reicht oft aus, um eine Lizenz zu fälschen, eine Inspektion zu "vergessen" oder eine bevorstehende Patrouille zu verraten. Gegen diese Form der Sabotage von innen sind selbst die modernsten Kriegsschiffe machtlos.
Juristische Labyrinthe und Schlupflöcher: Selbst wenn es einer Marine oder Küstenwache gelingt, einen illegalen Trawler auf frischer Tat zu ertappen und aufzubringen, ist der Kampf noch lange nicht gewonnen. Viele Küstenstaaten verfügen über veraltete oder unzureichende Fischereigesetze, die eine effektive Strafverfolgung, insbesondere von ausländischen Schiffen und deren Besatzungen, erschweren. Beweise sind schwer zu sichern, die Zuständigkeiten unklar, die Gerichte überlastet oder ebenfalls anfällig für Korruption. Das Ergebnis: Schätzungen zufolge enden über 70 % der aufgebrachten Fälle ohne Verurteilung oder mit nur geringfügigen Geldstrafen, die für die Betreiber der Trawler kaum mehr als Betriebskosten darstellen. Ein frustrierendes "Catch and Release"-Spiel für die Strafverfolgungsbehörden.
Chronischer Mangel an Ressourcen: Das vielleicht größte Hindernis ist oft der schlichte Mangel an Mitteln. Die senegalesische Marine, um ein Beispiel zu nennen, muss mit nur fünf größeren Patrouillenbooten eine Küstenlinie von 531 Kilometern überwachen – ein Gebiet, in dem sich oft Hunderte von Fischereifahrzeugen gleichzeitig aufhalten, darunter viele potenzielle illegale Akteure.
Das ist, als wollte man mit einem einzelnen Streifenwagen eine ganze Großstadt kontrollieren. Es fehlt an Schiffen, an Treibstoff, an gut ausgebildetem Personal, an Wartungskapazitäten – kurz gesagt: an allem.
Doch trotz all dieser Widrigkeiten gibt es sie, die Erfolgsgeschichten, die Hoffnung machen. In Liberia hat die bemerkenswerte Partnerschaft zwischen der nationalen Küstenwache und der oft als "Öko-Piraten" verschrienen, aber hoch effektiven NGO Sea Shepherd im Rahmen der „Operation Sola Stella“ eindrucksvolle Ergebnisse erzielt. Zwischen 2020 und 2023 konnten gemeinsam 12 große illegale Fischtrawler identifiziert, verfolgt und festgesetzt werden. Durch den kombinierten Einsatz von Sea Shepherds Schiffen, Aufklärungsdrohnen mit Wärmebildkameras und Nachtsichttechnologie konnten die Aufgriffsraten signifikant gesteigert werden – um 60 %. Dies zeigt, dass innovative Kooperationsmodelle und der Einsatz moderner Technologie einen echten Unterschied machen können.
Die ungewöhnliche Romanze: Umweltschützer im Schulterschluss mit Uniformierten
Diese Beispiele führen uns zu einer der faszinierendsten und vielleicht auch widersprüchlichsten Entwicklungen im Meeresschutz: die immer engere Zusammenarbeit zwischen Umweltschutzorganisationen und staatlichen Militär- und Sicherheitskräften. Organisationen wie OceanMind oder Global Fishing Watch agieren heute wie Hightech-Detekteien für die Ozeane. Sie nutzen öffentlich zugängliche und kommerzielle Satellitendaten (wie AIS, Radar und optische Bilder), kombinieren diese mit ausgeklügelten Algorithmen und künstlicher Intelligenz, um ein globales Bild der Fischereiaktivitäten zu zeichnen.
Sie können "dunkle Schiffe" identifizieren – also solche, die ihr AIS-Ortungssystem absichtlich abschalten, um illegalen Aktivitäten nachzugehen.
Sie können Bewegungsmuster analysieren, um festzustellen, ob ein Schiff wahrscheinlich fischt, und diese Daten mit bekannten Fischgründen und Schutzgebietsgrenzen abgleichen. Diese Informationen werden dann oft in Echtzeit an die zuständigen Marinen oder Küstenwachen weitergeleitet, die daraufhin gezielte Patrouillen starten können.
Ein beeindruckendes Beispiel für den Erfolg dieser technologischen Allianz liefert der kleine Pazifikstaat Palau. Die Regierung hat dort die mutige Entscheidung getroffen, 80 % ihrer riesigen ausschließlichen Wirtschaftszone (ein Gebiet größer als Spanien!) als Meeresschutzgebiet auszuweisen, in dem kommerzielle Fischerei weitgehend verboten ist. Um dieses gigantische Gebiet zu überwachen, hat Palau mit Unterstützung der USA ein hochmodernes maritimes Überwachungssystem ("Tactical Mobile Over-the-Horizon Radar") implementiert, das Radarstationen an Land mit Satellitenüberwachung und Patrouillenbooten kombiniert. Das Ergebnis: Die IUU-Fischerei in Palaus Gewässern konnte Berichten zufolge um dramatische 75 % reduziert werden. Präsident Surangel Whipps Jr. formulierte es treffend (sinngemäß): „Wir nutzen im Grunde dieselbe Technologie wie die US Navy, aber unser Ziel ist nicht die Bekämpfung von feindlichen Schiffen, sondern der Schutz unserer Haie, Thunfische und Korallenriffe.“ Eine "Militarisierung" im Dienste des Ökosystems.

Doch diese ungewöhnliche Kooperation ist nicht frei von Spannungen und ethischen Fallstricken. In Mexiko etwa führte die Zusammenarbeit der Marine mit US-Behörden und der NGO Sea Shepherd zum Schutz des vom Aussterben bedrohten Vaquita-Schweinswals (von dem Schätzungen zufolge nur noch etwa 10 Exemplare existieren!) zu heftigen Konflikten mit lokalen Fischern. Die Durchsetzung strenger Fangverbote, insbesondere für Kiemennetze, in denen sich die Vaquitas als Beifang verfangen, entzog vielen Fischern ihre Lebensgrundlage. Es kam zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, bei denen die Marine teilweise hart durchgriff.
Dieses Beispiel zeigt das schmerzhafte Dilemma auf, das entstehen kann, wenn dringender Artenschutz auf tief verwurzelte soziale und wirtschaftliche Realitäten trifft.
Der Einsatz militärischer Mittel kann hier leicht zu einer Eskalation führen und die Kluft zwischen Naturschützern und lokalen Gemeinschaften vertiefen.
Blick in die Zukunft: Brauchen wir eine „Grüne Marine“ mit Öko-Siegel?
Angesichts der globalen Dimension der IUU-Fischerei und ihrer Verbindungen zu anderen Formen der organisierten Kriminalität fordern Experten schon seit längerem eine grundlegend neue Herangehensweise: eine viel stärkere Integration von maritimer Sicherheitspolitik und Umweltschutz. Die Idee einer "grünen Marine" oder einer "ökologischen Küstenwache" gewinnt an Bedeutung. Es geht darum, dass der Schutz der marinen Ressourcen und Ökosysteme nicht nur als eine Aufgabe von Umweltministerien, sondern als integraler Bestandteil der nationalen Sicherheitsstrategie verstanden wird. Die EU hat hierfür im Rahmen ihrer "Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit" (PESCO – ja, der Name klingt immer noch furchtbar bürokratisch) Initiativen wie MARSUR (Maritime Surveillance) gestartet, die darauf abzielen, die Überwachungsfähigkeiten der europäischen Marinen zu bündeln und den Informationsaustausch zu verbessern, um IUU-Fischerei effektiver grenzübergreifend bekämpfen zu können. Auch die Vereinten Nationen drängen im Kontext des Nachhaltigkeitsziels 14 (Leben unter Wasser) auf die Etablierung einer globalen "Blauen Justiz", die Umweltverbrechen auf See konsequenter verfolgen soll.
Das klingt alles ambitioniert und richtig. Doch die Umsetzung scheitert oft am fehlenden politischen Willen und vor allem an den fehlenden finanziellen Mitteln. Es ist ein Hohn, dass laut OECD-Berichten die Staaten weltweit immer noch jährlich rund 22 Milliarden US-Dollar in schädliche Fischereisubventionen stecken – also Gelder, die oft direkt oder indirekt die Überkapazitäten der Fischereiflotten fördern und damit die Überfischung und IUU-Aktivitäten erst ermöglichen, die man an anderer Stelle mit teuren Militäreinsätzen zu bekämpfen versucht.
Das ist, als würde man gleichzeitig die Feuerwehr bezahlen und dem Brandstifter das Benzin subventionieren. Eine absolut schizophrene Politik.
Fazit: Ein diffuser Krieg ohne klare Fronten, aber mit dem Ozean als Hauptleidtragendem
Der Kampf gegen die illegale Fischerei auf den Weltmeeren gleicht einem asymmetrischen Krieg, einem Guerillakampf auf dem Wasser. Auf der einen Seite stehen (manchmal) hochgerüstete staatliche Akteure, unterstützt von NGOs mit beeindruckenden technologischen Fähigkeiten und getrieben von internationalen Abkommen und dem wachsenden öffentlichen Bewusstsein. Auf der anderen Seite agieren global vernetzte, flexible und oft skrupellose kriminelle Syndikate, die von den Schwächen der Rechtsstaatlichkeit, der allgegenwärtigen Korruption und der Armut in vielen Küstenregionen profitieren. Sie operieren im Schatten, wechseln Identitäten, nutzen Scheinfirmen und Flaggenstaaten mit laxen Kontrollen. Es ist ein Kampf David gegen Goliath, nur dass Goliath oft unsichtbar ist und sich ständig verwandelt.
Doch die ermutigenden Beispiele aus Ländern wie Liberia, Indonesien oder Palau zeigen, dass der Kampf nicht aussichtslos ist. Militarisierte Ansätze, der Einsatz von Technologie und entschlossene politische Führung können einen Unterschied machen. Sie können abschrecken, aufklären und illegale Akteure zur Rechenschaft ziehen. Aber – und das ist das entscheidende Aber – sie sind keine Wunderwaffe und kein Allheilmittel. Sie funktionieren nur dann nachhaltig, wenn sie Teil einer umfassenden, kohärenten Strategie sind. Eine Strategie, die nicht nur auf Abschreckung und Verfolgung setzt, sondern auch die Ursachen bekämpft: die Armut, die Menschen in die illegale Fischerei treibt; die Korruption, die sie ermöglicht; die schädlichen Subventionen, die sie anheizen; und die fehlenden alternativen Einkommensquellen für Küstengemeinden.
Sie müssen eingebettet sein in einen soliden rechtlichen Rahmen, flankiert von Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Fischereipraktiken und gestützt durch eine starke internationale Zusammenarbeit.
Für uns bei The Ocean Tribune bleibt die komplexe und vielleicht auch unbequeme Erkenntnis: Die Rettung unserer Ozeane vor der Plünderung erfordert ein breites Arsenal an Werkzeugen. Es braucht Schutzgebiete, nachhaltige Fangquoten und Aufklärungsarbeit, zweifellos. Aber in der rauen Realität der heutigen Weltmeere braucht es manchmal eben auch die Mittel der staatlichen Gewalt – Patrouillenboote, die nicht nur beobachten, sondern auch eingreifen können, Drohnen, die sehen, was im Verborgenen geschieht, und ja, vielleicht sogar das Drohpotenzial einer gut ausgerüsteten Marine. Doch der Einsatz dieser Mittel ist ein Tanz auf dem Vulkan. Der Preis ist hoch – nicht nur finanziell, sondern auch ökologisch, sozial und ethisch. Es ist ein ständiger Balanceakt, bei dem sichergestellt werden muss, dass die Medizin nicht schlimmer ist als die Krankheit und dass der Schutz der Fische nicht auf Kosten der Menschen geht – oder umgekehrt. Ein Dilemma, das uns noch lange beschäftigen wird.
Du kennst es bereits. Die Quellen:
FAO (2020): Illegal, Unreported and Unregulated Fishing.
EJF (2022): Pirates and Predators: How Maritime Militias Threaten West Africa’s Fisheries.
Global Fishing Watch (2023): Satellite Data Reveals Decline in IUU Fishing in Protected Areas.
ILO (2021): Forced Labor in Southeast Asia’s Fishing Industry.
Sea Shepherd (2023): Operation Sola Stella: Liberia’s Success Against IUU.
OECD (2022): Harmful Fisheries Subsidies: Trends and Impacts.
Klartext braucht eine starke Crew.
The Ocean Tribune ist zu 100% unabhängig, werbefrei und für alle frei zugänglich. Wir lassen uns von keiner Lobby kaufen, weil wir nur einer Sache verpflichtet sind: dem Ozean.
Das ist nur möglich, weil eine Crew von unerschrockenen Unterstützern hinter uns steht, die diesen Kurs finanziert. Wenn du unsere Arbeit wertvoll findest, dann werde jetzt Teil dieser Bewegung. Jeder Beitrag ist Treibstoff für unsere Mission und sorgt dafür, dass wir weiter die unbequemen Wahrheiten aussprechen können.
Aus der Werkstatt: Vom Problem zur Lösung
Aufklärung ist der erste Schritt. Die Umsetzung der zweite. Wir bei Vita Loom Labs entwickeln die professionellen Werkzeuge und strategischen Prozesse, die Impact-Organisationen dabei helfen, ihre Missionen wirkungsvoller zu machen.
Sie wollen sehen, wie unser strategischer Prozess in der Praxis aussieht? Unsere 'Blueprint Case Study' demonstriert Schritt für Schritt, wie wir aus einer guten Idee einen unwiderstehlichen, förderfähigen Antrag schmieden.
The Ocean Tribune
Wir wissen, was die Ozeane zu sagen haben!