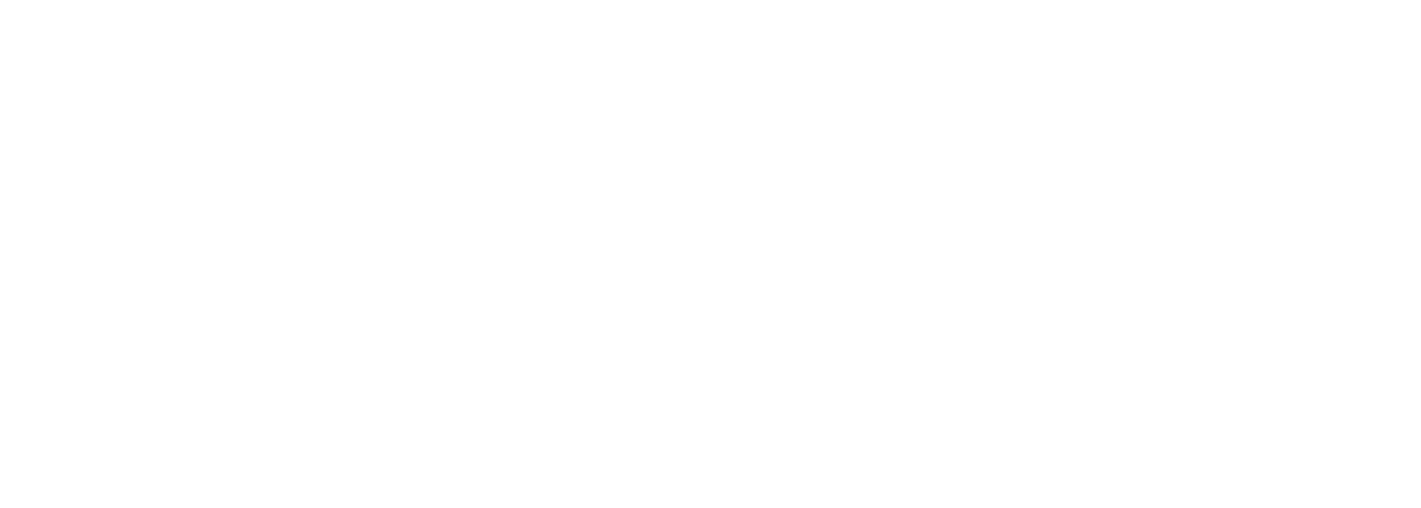Klartext Kormoran: Portrait eines Sündenbocks – und warum WIR das eigentliche Problem sind
- Barry Birdbrain
- 15. Nov. 2025
- 8 Min. Lesezeit


Von Barry Birdbrain
Ahoi, du Landratte mit Internetanschluss!
Barry Birdbrain hier, direkt vom Pier. Ich hab grad ‘nen Moment, weil meine Crew – die Möwen-Bande von The Ocean Tribune – sich drüben um eine gekenterte Fischkiste kümmert. Prioritäten, verstehst du? Und während ich hier so sitze und dem elegantesten Taucher seit Jacques Cousteau nachschaue, einem Kormoran, der sein Gefieder in der Sonne trocknet wie ein alter Rockstar seine Lederjacke, höre ich es vom Nachbarsteg rübergrölen. "Schwarze Pest!", keift einer im Anglerhut, "Die fressen uns die Haare vom Kopf!".
Ich könnte meinen Schnabel nicht halten, selbst wenn man ihn mir mit Seetang zubinden würde. Ich dreh mich also um und krächze: "Kumpel, wenn dir was die Haare vom Kopf frisst, dann ist es dein jämmerlicher Haarausfall, aber sicher nicht dieser Vogel da!" Zugegeben, die diplomatische Herangehensweise ist nicht so mein Ding. Aber mal ehrlich: Ist es nicht zum aus der Haut fahren? Wir vermasseln unsere Flüsse und Meere, betonieren die Ufer zu, kippen Dreck rein, fischen alles leer, was nicht bei drei auf den Bäumen ist – und dann zeigen wir mit dem salzigen Finger auf einen Vogel, der einfach nur seinen Job macht? Wer ist hier eigentlich die Pest?

Akte Kormoran: Steckbrief eines Sündenbocks
Okay, hol dein Notizbuch raus, es ist Zeit für Klartext. Bevor du weiter ins allgemeine Gezeter einstimmst, solltest du wissen, mit wem du es zu tun hast. Der Kormoran ist kein dahergelaufener Tunichtgut. Er gehört zur Familie der Phalacrocoracidae, ein schickes Wort für eine Bande von über 40 Arten von Wasservögeln, die auf jedem gottverdammten Kontinent außer der Antarktis zu Hause sind. In Europa haben wir es hauptsächlich mit zwei Unterarten zu tun: dem Phalacrocorax carbo carbo, der an den Felsküsten abhängt, und dem Phalacrocorax carbo sinensis, der sogenannten "Festlandsrasse".

Und jetzt kommt schon der erste Mythos, den wir kielholen [1] müssen. Wegen dieses "sinensis" – was "aus China" bedeutet – plärren einige Schlaumeier, der Vogel wäre eine invasive Art aus Asien. Das ist so ein Quatsch, da lachen ja die Heringsschwärme! Der Name "sinensis" kommt von einer alten Zeichnung, die gezähmte Kormorane in China beim Fischen zeigte. Tatsache ist, und das bestätigen dir selbst die Leute vom NABU, dass Kormorane hier seit der Eiszeit heimisch sind. Sie waren schon da, als deine Vorfahren noch mit Keulen aufeinander eingedroschen haben.
Ein ausgewachsener Kormoran ist ein stattlicher Vogel, so zwischen 80 und 100 Zentimeter groß, mit einer Flügelspannweite von bis zu 1,60 Metern und einem Gewicht von bis zu 3 Kilogramm. Sein Gefieder schimmert bei Sonnenschein metallisch grün und bläulich – ein echter Hingucker. Der Schnabel ist lang und an der Spitze hakenförmig, perfekt, um glitschige Beute zu packen. Und seine Augen? Smaragdgrün. Ein echter Charakterkopf. Die Weibchen sind meist etwas zierlicher, aber genauso taff.

Der Tauchgang eines Meisters: Kein Vogel, ein U-Boot
Jetzt zur Hauptsache: dem Fressen. Ja, Kormorane fressen Fisch. Überraschung! Ein Vogel, der am Wasser lebt, frisst Fisch. Bahnbrechende Erkenntnis. Im Schnitt verdrückt ein Kormoran etwa 400 - 500 Gramm am Tag. Die Angler-Propaganda spricht manchmal von 700 Gramm oder mehr, aber das sind Schauergeschichten für's Lagerfeuer. Dabei ist er kein Feinschmecker. Er ist ein Opportunist und schnappt sich, was am einfachsten zu kriegen ist. Und das sind, wie Nahrungsanalysen belegen, meist wirtschaftlich unbedeutende Kleinfische wie Rotaugen oder Brachsen, die in Massen vorkommen.

Sein Jagdverhalten ist eine Meisterleistung. Er kann bis zu 30 Meter tief tauchen und bis zu 90 Sekunden unter Wasser bleiben. Sein Trick dabei ist genial und einzigartig: Im Gegensatz zu Enten, deren Gefieder wasserdicht ist, saugt sich das Gefieder des Kormorans teilweise mit Wasser voll. Das klingt erstmal nach einem Nachteil, aber es reduziert den Auftrieb und macht ihn unter Wasser wendiger und schneller. Er ist quasi ein lebendes Torpedo. Seine Knochen haben zudem weniger Lufteinschlüsse als bei anderen Vögeln. Nach dem Tauchgang siehst du ihn dann in seiner ikonischen Pose am Ufer sitzen, die Flügel weit ausgebreitet, um sein nasses Gefieder in der Sonne zu trocknen.
Das ist kein Posen für Instagram, das ist überlebenswichtige Thermoregulation.
Und er ist nicht dumm. Kormorane sind soziale Tiere, die oft in Kolonien brüten und sogar gemeinsam jagen. Manchmal bilden sie Formationen, treiben die Fische zusammen und schlagen dann gemeinsam zu – eine Effizienz, von der so manche menschliche Firma nur träumen kann.
Freund oder Feind? Die unbequeme Wahrheit über unser Ökosystem
Kommen wir zum Kern des Pudels, oder besser, des Kormorans: Ist es ethisch vertretbar, ihn abzuschießen, weil er Fischern und Anglern Konkurrenz macht? Meine klare Antwort aus der Möwenperspektive: Nein, verdammt noch mal! Es steht uns nicht zu.
Der Kormoran ist nicht die Krankheit, er ist das Symptom.
Jahrzehntelang haben wir unsere Flüsse begradigt, Auen trockengelegt, Laichplätze zerstört und unsere Gewässer mit Schadstoffen belastet. Das hat die Fischbestände geschwächt, lange bevor der Kormoran wieder in größerer Zahl auftauchte. Der Vogel war bei uns im Binnenland fast ausgerottet – durch gnadenlose Verfolgung bis ins 20. Jahrhundert hinein. Erst durch Schutzmaßnahmen haben sich die Bestände erholt. Und jetzt, wo er wieder da ist, in einem von Menschen geschädigten System, soll er der Schuldige sein? Das ist, als würdest du ein Feuer legen und dann die Feuerwehr für den Wasserschaden verantwortlich machen.
Die Natur braucht den Kormoran. Er ist ein wichtiger Regulator. Er hält Fischpopulationen gesund, indem er oft die schwächeren oder kranken Tiere erwischt und die übermäßige Vermehrung von Massenfischarten eindämmt. Er ist ein Indikator für Wasserqualität: Wo Kormorane jagen, gibt es Fisch, und wo es Fisch gibt, ist das Wasser zumindest halbwegs in Ordnung.
Wer frisst eigentlich den Kormoran? Nun, erwachsene Vögel haben kaum natürliche Feinde. Der mächtige Seeadler ist einer der wenigen, der ihm gefährlich werden kann. Für seine Eier und Küken sieht es anders aus: Waschbären, die auf die Brutbäume klettern, können ganze Kolonien auslöschen. Aber der größte Feind war und ist der Mensch.
Würde es keine Kormorane mehr geben, würde ein wichtiger Teil des Nahrungsnetzes fehlen. Die Regulation der Fischbestände fiele weg, was zu unausgewogenen Populationen führen könnte. Wir würden ein wichtiges Barometer für die Gesundheit unserer Gewässer verlieren.
Ein Blick ins Familienalbum des Kormorans
Kormorane sind Koloniebrüter. Zur Balzzeit, die schon im Februar beginnen kann, führen die Männchen beeindruckende Tänze auf, werfen den Kopf zurück und präsentieren ihr Prachtkleid, das weiße Flecken an Kopf und Schenkeln zeigt. Sie brüten einmal im Jahr. Das Weibchen legt 3 - 5 Eier, die von beiden Eltern rund 28 Tage bebrütet werden.
Die Küken schlüpfen nackt und blind und sehen aus wie kleine, unfertige Dinosaurier. Sie werden von den Eltern mit vorverdautem Fisch gefüttert. In den ersten zwei Jahren tragen sie ein unauffälliges, bräunliches Jugendkleid, oft mit hellem Bauch. Mit etwa zwei Monaten sind sie flügge, bleiben aber noch wochenlang von den Eltern abhängig. Erst mit drei oder vier Jahren werden sie selbst geschlechtsreif. Die Kommunikation in der Kolonie ist ein Spektakel aus tiefen, krächzenden und gurgelnden Lauten – eine Art Kormoran-Heavy-Metal-Konzert. Ein Kormoran kann übrigens steinalt werden. Der Rekord liegt bei über 32 Jahren!
Vom Sündenbock zum Partner: Es geht auch anders
Anstatt mit dem Gewehr am Ufer zu stehen, könnten wir unsere Energie in echte Lösungen stecken. Das Problem sind nicht die paar Fische im Kormoran-Magen, sondern unsere kaputten Gewässer.
Renaturierung: Geben wir den Flüssen ihre Kurven und Auen zurück! Schaffen wir natürliche Laich- und Rückzugsgebiete für Fische. Ein gesunder, strukturreicher Fluss bietet Fischen genug Versteckmöglichkeiten.
Schutz für Fischfarmen: An künstlichen Teichwirtschaften können Kormorane tatsächlich ein Problem sein. Aber anstatt die Vögel zu töten, kann man die Teiche mit Netzen überspannen. Das ist eine effektive und gewaltfreie Lösung.
Perspektivwechsel: Wir müssen aufhören, die Natur als unseren persönlichen Supermarkt zu betrachten. Wildtiere sind keine Konkurrenten, sie sind Teil eines komplexen Systems, das wir schützen sollten, anstatt es für unsere Bequemlichkeit zu verstümmeln.
Ein glücklicher Kormoran braucht nicht viel: sauberes Wasser mit ausreichend Fisch, sichere Plätze zum Rasten und Brüten ohne Störung und keine ignoranten Menschen, die ihn als Zielscheibe missbrauchen.
Der Klimawandel setzt ihm zusätzlich zu, da sich die Wassertemperaturen verändern und seine Nahrungsquellen bedrohen. Gleichzeitig passen sich die Vögel an, ändern ihre Zugrouten – ein Zeichen ihrer unglaublichen Resilienz. Davon könnte sich die Gattung Mensch mal eine Scheibe abschneiden - oder nicht?
Der Tritt in den Hintern: Dein Job, Skipper!
So, und jetzt kommst du ins Spiel. Was kannst du tun?
Informiere dich und andere: Wenn du das nächste Mal jemanden über die "schwarze Pest" schimpfen hörst, wirf ihm ein paar Fakten an den Kopf. Wissen ist die beste Waffe gegen Ignoranz.
Unterstütze Naturschutzorganisationen: Leute wie der NABU oder der LBV kämpfen für den Schutz von Lebensräumen. Jeder Euro hilft, Flüsse zu renaturieren und Aufklärungsarbeit zu leisten.
Beobachte, statt zu verurteilen: Fahr doch mal raus und schau dir diese faszinierenden Vögel an! In der DACH-Region [2] gibt es fantastische Orte dafür, zum Beispiel den Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft in Deutschland, die großen Seen und den Inn in Österreich oder die Ufer des Genfersees in der Schweiz. Wenn du einen Kormoran siehst: Halt Abstand, sei leise und genieß das Schauspiel.
In vielen Kulturen gilt der Kormoran als Krafttier. Er symbolisiert die Fähigkeit, tief in die eigene Seele (das Wasser) zu tauchen, um Weisheit zu finden, und dann wieder aufzutauchen und die Dinge aus einer höheren Perspektive (der Luft) zu betrachten. Er steht für Ausgeglichenheit, Mut und Selbsterkenntnis. Vielleicht sollten wir ihn weniger als Feind und mehr als Lehrer sehen.
Bevor ich jetzt zu meiner hungrigen Crew stoße, hier noch ein paar geniale Fakten zum Angeben in der Hafenkneipe:
15 phänomenale Fakten über den Kormoran
Sein Name kommt vom Lateinischen "Corvus Marinus" – "Meerrabe".
Seine Augen sind leuchtend smaragdgrün.
Er kann über 30 Jahre alt werden.
Sein Gefieder ist absichtlich nicht komplett wasserdicht, um besser tauchen zu können.
Er jagt oft in organisierten Gruppen.
In Asien (z.B. Japan und China) wird er seit Jahrhunderten als gezähmter Helfer für den Fischfang eingesetzt.
Kormorane sind eine uralte Vogelgruppe.
Ein Kormoran-Küken wird nackt und blind geboren.
Er ist ein heimischer Vogel in Europa, kein Einwanderer.
Sein Kot (Guano) ist extrem nährstoffreich und zerstört auf Dauer die Brutbäume – ein natürlicher Kreislauf der Sukzession.
Er war in Deutschland und Österreich Vogel des Jahres 2010, um auf seine Verfolgung aufmerksam zu machen.
Er kann seine Augen unter Wasser durch eine transparente Nickhaut wie mit einer Taucherbrille schützen.
Männchen und Weibchen kümmern sich gemeinsam um Brut und Aufzucht.
An großen Schlafplätzen können sich im Winter Tausende von Kormoranen versammeln.
Er ist ein lebender Indikator für die Wassergesundheit.
Hör auf, einen Sündenbock für unsere eigenen Fehler zu suchen. Der Kormoran ist ein Überlebenskünstler, ein Meistertaucher und ein integraler Bestandteil unserer Natur. Lass ihn verdammt noch mal in Ruhe seinen Job machen. Vielleicht können wir von seiner Anpassungsfähigkeit ja noch was lernen.
Barry out. Die Fischkiste ruft.
Fußnoten:
[1] "Kielholen müssen" ist eine Redewendung, die bedeutet, dass jemand eine schwere, schmerzhafte und demütigende Strafe erleiden muss. Ursprünglich war das Kielholen eine grausame körperliche Züchtigung in der Seefahrt, bei der eine Person unter dem Schiff durchgeschleift wurde und dabei durch den Rumpf der Kiel und die Planken am Rumpf verletzte. Die Redewendung hat sich zu einer metaphorischen Beschreibung für eine Strafe entwickelt, die man durch harte oder unangenehme Aufgaben erhalten muss.
[2] DACH-Region = Die DACH-Region ist eine Abkürzung für die deutschsprachigen Länder Deutschland, Austria (Österreich) und die CH-Schweiz. Der Begriff wird häufig verwendet, um eine gemeinsame kulturelle, sprachliche und wirtschaftliche Einheit zu beschreiben.
Wir bei The Ocean Tribune werfen dir die Fakten wie eine Flaschenpost vor die Füße – ungeschönt und ohne Schleifchen. Du bist ein freier Mensch auf einem freien Ozean und kannst deinen eigenen Kurs setzen, da quatscht dir keiner rein. Wir würden uns aber freuen, wenn du nach dem Lesen unserer Berichte deinen Kompass mal überprüfst und vielleicht einen Haken um die größten Eisberge der Dummheit schlägst. Am Ende geht's uns nicht darum, Leute in "gute Umweltschützer" und "böse Plastiktüten-Nutzer" zu sortieren. Es geht darum, wieder Respekt zu zeigen und genug Empathie im Herzen zu haben, um zu kapieren, dass der Kahn, der uns alle trägt, und seine tierische Mannschaft mehr sind als nur eine Kulisse für unseren Törn. Denn wenn dieses Schiff leckschlägt, ist es völlig egal, wer auf der Backbord- oder Steuerbordseite stand – wir gehen alle zusammen unter.
Klartext braucht eine starke Crew.
The Ocean Tribune ist zu 100% unabhängig, werbefrei und für alle frei zugänglich. Wir lassen uns von keiner Lobby kaufen, weil wir nur einer Sache verpflichtet sind: dem Ozean.
Das ist nur möglich, weil eine Crew von unerschrockenen Unterstützern hinter uns steht, die diesen Kurs finanziert. Wenn du unsere Arbeit wertvoll findest, dann werde jetzt Teil dieser Bewegung. Jeder Beitrag ist Treibstoff für unsere Mission und sorgt dafür, dass wir weiter die unbequemen Wahrheiten aussprechen können.
Aus dem Maschinenraum: Vom Klartext zum Bauplan
Wir legen den Finger in die Wunde. Das ist unsere Mission bei The Ocean Tribune. Aber Aufklärung allein rettet keine Ozeane.
In der Werkstatt von Vita Loom Labs schmieden wir aus diesem Wissen die unangreifbaren Architekturen, die aus fragilen Projekten resiliente, investierbare Assets machen. Wir schreiben keine besseren Anträge. Wir bauen unbesiegbare Systeme.
Wollen Sie sehen, wie eine solche architektonische Intervention in der Praxis aussieht? Unsere Fallstudie seziert den Prozess – vom narrativen Vakuum zum unbesiegbaren System.
The Ocean Tribune
Wir wissen, was die Ozeane zu sagen haben!