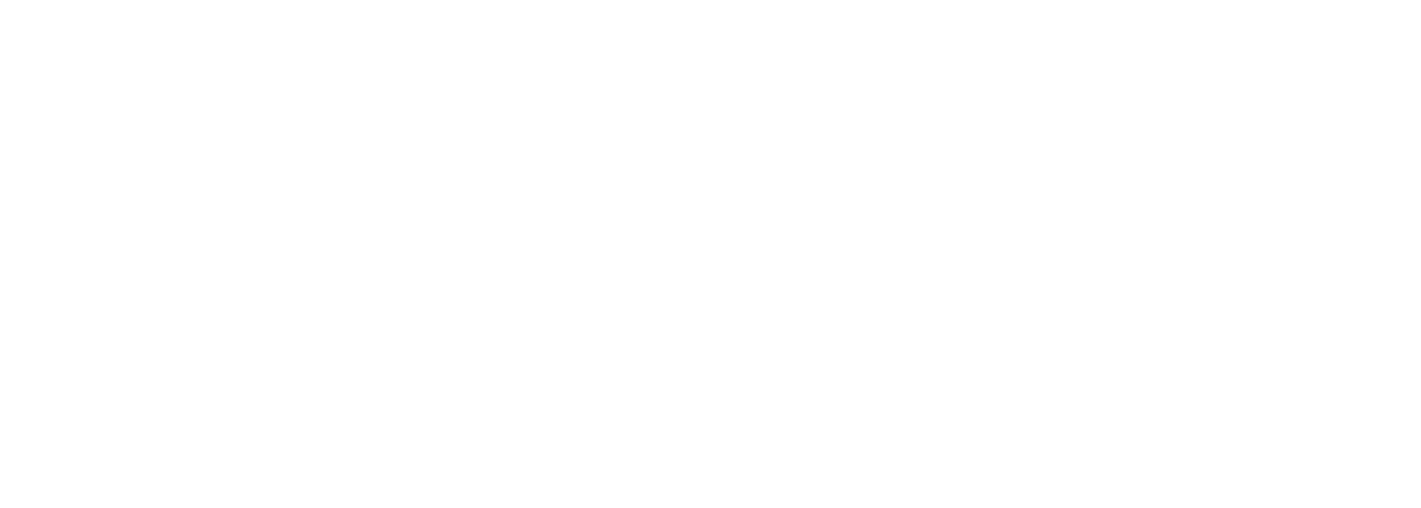Die Akte Robbe: Zwischen Kulleraugen-Mythos und knallharten Überlebenskampf
- Gary Gullson
- 30. Sept. 2025
- 13 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 6. Okt. 2025


Von Gary Gullson
Ich saß neulich an der Pier, hab mir eine leicht ranzige Makrele gegönnt und den Zweibeinern zugesehen, wie sie ihre Smartphones auf alles richten, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Plötzlich Gekreische. Eine junge Kegelrobbe, kaum größer als ein Seesack, hatte sich zum Dösen auf den Strand gezerrt. Und was macht der Homo Sapiens im Funktions-Outfit? Er zückt das Selfie-Stäbchen und robbt – ja, die Ironie ist mir nicht entgangen – auf das Tier zu. "Guck mal, Schatzi, wie süüüüß! Die will bestimmt kuscheln!"
Mir ist fast die Makrele aus dem Schnabel gefallen. KUSCHELN? Ein Raubtier? Das größte Raubtier Deutschlands, um genau zu sein? Sag mal, geht’s noch? Hast du Lack gesoffen oder glaubst du wirklich alles, was dir die Plüschtier-Industrie seit deiner Geburt ins Hirn gehämmert hat? Eine Robbe ist kein flauschiger Labrador mit Flossen. Das ist eine perfekt an ihren Lebensraum angepasste Jagdmaschine, die dich mit einem einzigen Biss in eine wandelnde Bakterienkultur verwandeln kann, gegen die handelsübliche Antibiotika aussehen wie homöopathische Zuckerkügelchen.
Dieser Vorfall, so banal er klingt, ist der Grund, warum ich diesen Bericht hier runterschreibe. Weil ihr da draußen anscheinend den Bezug zur Realität verloren habt. Ihr seht ein Wildtier und wollt es anfassen, füttern oder für euer Instagram-Profil ausbeuten. Es ist zum aus der Haut fahren. Also, setzt dich hin, hol dir ein Bier und hör dem alten Gary mal zu. Es ist Zeit für eine Lektion in Sachen Robben, die du so schnell nicht vergessen wirst.
Klartext: Das Who's Who der Flossenfüßer
Also, was sind Robben überhaupt? Wissenschaftlich korrekt heißen die Jungs und Mädels "Pinnipedia", was aus dem Lateinischen kommt und so viel wie "Flossenfüßer" bedeutet. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Sie sind Säugetiere und gehören zur Ordnung der Raubtiere. Ihre Vorfahren waren hundeartige Landratten, die irgendwann vor rund 25 Millionen Jahren dachten: "Pfft, Land ... ist doch langweilig. Gehen wir ins Wasser." Seitdem haben sie ihre Körper zu stromlinienförmigen Torpedos umgebaut, perfekt für die Jagd unter Wasser.
Weltweit gibt es, nach dem der Mensch den Japanischen Seelöwen und die Karibische Mönchsrobbe erfolgreich ausgerottet hat, noch 34 lebende Arten. Die Wissenschaftler, in ihrem unbändigen Drang, alles in Schubladen zu stecken, teilen sie in drei große Familien ein:
Hundsrobben (Phocidae): Das sind die klassischen "Robben", die den meisten in den Sinn kommen. Sie haben keine sichtbaren Ohrmuscheln (nur Löcher im Kopf) und ihre Hinterflossen sind starr nach hinten gerichtet. An Land sind sie deshalb eine Katastrophe. Sie müssen sich auf dem Bauch vorwärts quälen – daher das Wort "robben". Im Wasser aber, mein Freund, da sind sie die Könige. Der Antrieb kommt aus dem ganzen Hinterkörper, eine unglaublich effiziente Bewegung. Zu dieser Familie gehören unsere heimischen Stars, der Seehund und die Kegelrobbe, aber auch die riesigen See-Elefanten.
Hier dazu die Eselsbrücke (Mnemotechnik):
Hundsrobbe = "Keine Ohren, kann nicht laufen"
Ohrenrobben (Otariidae): Wie der Name schon vermuten lässt, haben diese Gesellen kleine, sichtbare Ohrmuscheln. Der größte Unterschied zu den Hundsrobben ist aber die Beweglichkeit. Ohrenrobben können ihre kräftigen Hinterflossen unter den Körper drehen und an Land regelrecht laufen, wenn auch etwas watschelnd. Im Wasser benutzen sie hauptsächlich ihre langen Vorderflossen zum Antrieb, fast so, als würden sie fliegen. Seelöwen und Seebären gehören in diese Kategorie. Sie sind oft sozialer und bilden riesige Kolonien.
Hier dazu die Eselsbrücke (Mnemotechnik):
Ohrenrobbe = "Ohren dran, läuft wie ein Betrunkener"
Walrosse (Odobenidae): Es gibt nur eine Art, und die ist unverkennbar. Ein riesiger Haufen Fett und Muskeln mit zwei gewaltigen Hauern, die aus dem Oberkiefer ragen. Sie haben keine Ohrmuscheln, können ihre Hinterflossen aber wie die Ohrenrobben zum Laufen einsetzen. Sie sind eine Art Zwischen-Ding.
Hier dazu die Eselsbrücke (Mnemotechnik):
Walross = "Hat Stoßzähne, weil er's kann"
Diese Familien haben sich über den ganzen Globus verteilt. Die meisten mögen es kalt und leben in den Polar- und gemäßigten Zonen, aber es gibt auch Ausnahmen wie die Hawaii-Mönchsrobbe, die es sich in den Tropen gemütlich macht. Einige wenige Arten sind sogar komplett ins Süßwasser abgewandert, wie die Baikalrobbe im russischen Baikalsee oder die Saimaa-Ringelrobbe in Finnland. An Nord- und Ostsee triffst du hauptsächlich auf zwei Vertreter: den Seehund (Phoca vitulina) und die Kegelrobbe (Halichoerus grypus).
Noch nicht genug? 8 Fakten für Angeber, die dir die Socken ausziehen
Du denkst, jetzt weißt du alles? Weit gefehlt, mein Freund. Hier ist der Stoff, mit dem du an jeder Hafenkneipen-Theke punktest:
Die fettigste Milchbar der Welt: Du findest, Sahne ist fett? Lächerlich. Die Milch der Klappmützenrobbe enthält über 60% Fett. Das ist fast wie reine Butter. Damit katapultiert die Mutter ihr Junges in nur vier Tagen von 22 auf 40 Kilo. Das ist die kürzeste Säugezeit aller Säugetiere. Effizienz, Baby!
Schlafen mit halbem Hirn: Wie schlafen Robben im Wasser, ohne zu ertrinken? Ganz einfach: Sie schalten nur eine Gehirnhälfte ab. Die andere Hälfte bleibt wach, steuert das Auftauchen zum Luftholen und hält nach Feinden Ausschau. Stell dir das mal im Büro vor. Eine Hälfte pennt, die andere tippt E-Mails. Genial.
Tränen lügen nicht? Doch, und wie! Wenn du eine Robbe an Land siehst, die aussieht, als würde sie weinen, dann pack die Taschentücher wieder weg. Sie hat keinen Liebeskummer. Robben haben keine Tränenkanäle wie wir. Sie sondern eine ölige Flüssigkeit ab, um ihre Augen vor dem Salzwasser zu schützen und an Land feucht zu halten. Das ist reine Augenpflege, kein Drama.
Legales Blutdoping ab Werk: Der unangefochtene Champion im Tiefseetauchen unter den Robben ist der Südliche See-Elefant. Dieser Koloss kann in Tiefen von über 2.000 Metern abtauchen und dabei bis zu zwei Stunden die Luft anhalten. Wie er das macht? Legales Blutdoping ab Werk. Sein Blut enthält extrem viel Hämoglobin und seine Muskeln sind vollgestopft mit Myoglobin. Das sind Sauerstoff-Speicher-Proteine. Im Grunde hat er einen eingebauten Presslufttank im Körper, der jeden menschlichen Apnoetaucher vor Neid erblassen lässt.
Der schlimmste Sonnenbrand der Welt: See-Elefanten machen einmal im Jahr einen sogenannten "katastrophalen Fellwechsel". Das bedeutet nicht, dass sie ein paar Haare verlieren. Nein, sie stoßen die komplette obere Hautschicht mitsamt dem alten Fell in großen Fetzen ab. In dieser Zeit liegen sie wochenlang apathisch am Strand, fasten und sehen aus wie ein Zombie nach einem Industrieunfall.
Die steinreiche Diät: Im Magen mancher Robbenarten, besonders bei Seelöwen, finden Forscher regelmäßig Steine, manchmal kiloweise. Warum sie die fressen, ist bis heute nicht zu 100% geklärt. Dienen sie als Ballast für die Tauchgänge? Helfen sie beim Zermalmen von Nahrung? Oder bekämpfen sie einfach nur das Hungergefühl während der Fastenzeiten? So oder so, eine ziemlich harte Diät.
Unterwasser-Techno: Du denkst, nur Delfine machen coole Geräusche? Dann hör dir mal eine Weddellrobbe unter dem antarktischen Eis an. Die produzieren eine ganze Symphonie aus Trillern, Zirpen, Pfeiftönen und Geräuschen, die klingen wie aus einem Science-Fiction-Film der 80er. Damit kommunizieren und navigieren sie in völliger Dunkelheit.
Ein 3D-GPS im Gesicht: Ihre Barthaare (Vibrissen) sind weit mehr als nur ein Schnurrbart. Eine Studie, veröffentlicht im Journal of Experimental Biology, hat gezeigt, dass eine Robbe mit verbundenen Augen der Spur eines Mini-U-Boots folgen kann, das 30 Sekunden vor ihr vorbeigefahren ist – nur anhand der Wasserverwirbelungen, die sie mit ihren Barthaaren spürt. Das ist kein Tastsinn mehr, das ist ein eingebautes 3D-Navigationssystem.
Steckbrief der Lokalmatadore: Seehund vs. Kegelrobbe
Größe & Gewicht
Seehund: Männchen bis 1,7m, 100 Kilogramm. Eher der kompakte Typ.
Kegelrobbe: Männchen bis 2,5m, 300 Kilogramm. Ein echtes Kaliber und Deutschlands größtes Raubtier.
Kopfform
Seehund: Rund, fast katzenartig, mit einer Stupsnase. Der "süße" von beiden.
Kegelrobbe: Länglich, kegelförmig (daher der Name), mit einer geraden "römischen" Nase. Wirkt eher wie ein grimmiger Türsteher.
Fellfarbe
Seehund: Grau mit dunklen Flecken, individuell sehr variabel.
Kegelrobbe: Männchen: Dunkelgrau mit hellen Flecken. Weibchen: Hellgrau/Silber mit dunklen Flecken.
Lebensraum (D)
Seehund: Hauptsächlich im Wattenmeer der Nordsee, in der Ostsee sehr selten.
Kegelrobbe: Nordsee (Helgoland) und zunehmend wieder in der Ostsee.
Charakter
Seehund: Scheu, liegt oft in der typischen "Bananenform" auf Sandbänken.
Kegelrobbe: Neugierig, aber auch deutlich wehrhafter.
Der Magen knurrt: Eine Robbe hat immer Hunger
Kommen wir zum Eingemachten. Was frisst so ein Tier den ganzen Tag? Die kurze Antwort: Alles, was es kriegen kann. Robben sind opportunistische Fleischfresser. Ihre Hauptnahrungsquelle ist Fisch, aber je nach Art und Verfügbarkeit stehen auch Tintenfische, Krebstiere, Muscheln und manchmal sogar Seevögel wie Pinguine auf dem Speiseplan.
Die Menge ist beeindruckend. Eine ausgewachsene Kegelrobbe verdrückt am Tag zwischen 5 und 7 Kilogramm Fisch. Ein Seehund braucht etwa 4 bis 6 Kilogramm. Das ist, als würdest du jeden Tag 20 bis 30 große Portionen Fish and Chips essen – aber ohne die Chips. Um diese Beute zu fangen, sind sie perfekt ausgestattet. Ihre Augen sind an die schlechten Lichtverhältnisse unter Wasser angepasst. Richtig spannend wird es aber bei ihren Barthaaren, den Vibrissen, die, wie du jetzt weißt, ein biologisches Wunderwerk sind.
Eine Robbe "sieht" ihre Beute also nicht nur mit den Augen, sondern "fühlt" sie mit ihrem ganzen Gesicht. Das ist Hightech-Sensorik, von der jeder U-Boot-Ingenieur nur träumen kann.
Die Nahrungspyramide ist ein brutales Geschäft. Die Robbe frisst Fisch. Und wer frisst die Robbe? An der Spitze der Nahrungskette lauern die wahren Giganten der Meere: Schwertwale (Orcas) und große Haiarten wie der Weiße Hai. In der Arktis ist der Eisbär zum ultimativen Lauerjäger geworden, spezialisiert auf einen schwachen Moment der Robbe. Anstatt sie im Wasser zu jagen, wartet er geduldig an ihren Atemlöchern im Eis. Wenn die Robbe zum Luftholen kommt, schlägt die Falle zu und der Bär sichert sich seine überlebenswichtige, fette Mahlzeit. Und in der Antarktis gibt es sogar eine Robbenart, den Seeleoparden, der sich auf die Jagd nach seinen kleineren Verwandten spezialisiert hat. Es ist ein ständiges Fressen und Gefressen werden. Der Ozean ist kein Streichelzoo.
Warum ein Ozean ohne Robben ein schlechter Witz wäre
Jetzt fragst du dich vielleicht: "Okay, Gary, die sind also gute Jäger. Aber brauchen wir die wirklich?" Kapier's endlich: Jedes einzelne Lebewesen in diesem blauen Sumpf hat seine Aufgabe. Robben sind ein entscheidender Teil des marinen Ökosystems.
Sie sind das, was man eine "Schlüsselart" nennt. Als Top-Prädatoren regulieren sie die Bestände von Fischen und anderen Meerestieren. Sie halten die Populationen gesund, indem sie oft die schwachen oder kranken Tiere erbeuten. Würden sie wegfallen, könnten sich bestimmte Fischarten unkontrolliert vermehren, was das gesamte Gleichgewicht durcheinander bringen würde.
Aber es geht noch weiter. Greenpeace-Berichte weisen darauf hin, dass Robben auch als "Nährstoff-Mixer" fungieren. Durch ihre Tauchgänge und Bewegungen im Wasser wirbeln sie Nährstoffe vom Meeresboden auf und transportieren sie in andere Wasserschichten und in Küstennähe. Das kommt wiederum anderen, kleineren Organismen zugute. Ihr Kot ist außerdem ein wichtiger Dünger für das Plankton. Ohne Robben würde das Ökosystem ärmer, instabiler und am Ende kollabieren.
Ein Ozean ohne Robben ist wie ein Motor ohne Öl – er mag noch kurz laufen, aber der Kolbenfresser ist vorprogrammiert.
Vom Kinderzimmer bis ins hohe Alter: Ein Robbenleben im Zeitraffer
Die Fortpflanzung ist bei den meisten Robbenarten ein jährliches Spektakel. Die Männchen kommen oft zuerst an den Paarungsplätzen an, um die besten Reviere zu besetzen. Bei Arten wie den See-Elefanten oder den Seelöwen kommt es dann zu brutalen Kämpfen, bei denen sich die Bullen blutige Verletzungen zufügen, um einen Harem von Weibchen zu erobern. Das ist testosterongeladener Wahnsinn.
Die Paarung findet je nach Art an Land oder im Wasser statt. Und jetzt kommt ein genialer Trick der Natur: Viele Robbenarten haben eine sogenannte "Keimruhe". Nach der Befruchtung nistet sich die Eizelle nicht sofort in der Gebärmutter ein, sondern macht erstmal eine Pause von ein paar Monaten. Das sorgt dafür, dass die Jungen jedes Jahr zur exakt gleichen, günstigen Zeit geboren werden, obwohl die Paarungszeit direkt nach der letzten Geburt liegt.
Die Tragzeit dauert, inklusive Keimruhe, etwa 11 bis 12 Monate. In der Regel kommt nur ein einziges Junges zur Welt. Zwillingsgeburten sind extrem selten und meist ein Todesurteil für eines der Jungen, weil die Milch der Mutter nicht für zwei reicht.
Die Robbenbabys, auch "Heuler" genannt (weil sie nach ihrer Mutter rufen, wenn sie getrennt werden), sind bei der Geburt schon gut entwickelt. Ein Kegelrobben-Baby wiegt um die 15 Kilogramm und ist mit einem dichten, weißen Babyfell (Lanugo) bedeckt, das es an Land warm hält, aber im Wasser nicht gut isoliert. In den ersten drei Wochen werden sie mit extrem fetthaltiger Milch gesäugt und nehmen pro Tag bis zu 2 Kilogramm zu. Danach verlässt die Mutter sie und die Kleinen müssen allein klarkommen. Sie zehren von ihren Fettreserven, während sie jagen lernen – ein brutaler Start ins Leben.
Und wer wird älter? Meistens die Weibchen. Bei vielen Arten liegt die Lebenserwartung bei etwa 30 bis 40 Jahren. Die Männchen, besonders die dominanten Bullen, die sich in ständigen Revierkämpfen aufreiben, sterben oft deutlich früher.
Die Wende: Es gibt noch Hoffnung für die Flossenfüßer
Okay, genug der harten Fakten. Es klingt düster, ich weiß. Die Menschheit hat die Robben über Jahrhunderte abgeschlachtet – für Fell, Öl und aus reiner Dummheit, weil man sie als Konkurrenz für die Fischerei sah. Moment mal Öl? Ja, du hast richtig gelesen und warum das erfährst du jetzt.
Aber dafür muss dein Hirn einmal 150 bis 200 Jahre zurückspulen, in eine Zeit vor Erdöl, vor Elektrizität, vor der modernen Chemie. In dieser Welt war Fett – und besonders hochwertiges, flüssiges Fett, also Öl – eine der wertvollsten Ressourcen überhaupt.
Und Robben, mein Freund, sind nichts anderes als schwimmende, perfekt isolierte Öl-Fässer.
Hier ist die knallharte Erklärung, warum man Robben wegen ihres Öls abgeschlachtet hat:
Der Schlüssel zu allem ist der Blubber. Das ist die dicke, fette Isolierschicht direkt unter der Haut der Robbe. Biologisch ist sie für das Tier überlebenswichtig, um im eiskalten Wasser nicht zu erfrieren und als gigantischer Energiespeicher. Für die Menschen war dieser Blubber (dicke Fettschicht) das Ziel.
Doch warum wird zur dicken Fettschicht von Walen und Robben - BLUBBER gesagt?
Das Geräusch beim Auskochen
Wenn die Wal- und Robbenfänger den fetten Speck in riesigen Kesseln an Bord ihrer Schiffe oder an Land ausgekocht haben, um den wertvollen Tran (das Öl) zu gewinnen, was hat das gemacht? Es hat gebrodelt, gegluckert, es hat geblubbert. Die Luft war erfüllt von diesem Geräusch, dem Blubb-Blubb-Blubb des schmelzenden Fetts. Die Jäger haben dem Zeug einfach den Namen seines eigenen Todesgeräuschs gegeben. Brutal, aber praktisch.
Die zitternde, schwabbelige Beschaffenheit
Und dann fass das Zeug mal an (oder stell es dir vor). Das ist kein fester, harter Speck wie bei einem Schwein. Blubber ist eine zitternde, schwabbelige, fast halbflüssige Masse, die bei jeder Bewegung nachzittert. Wenn du mit dem Finger draufdrückst, macht es blubb. Wenn ein riesiges Stück davon auf Deck fällt, macht es blubb. Das englische Verb "to blubber" bedeutet ja auch so viel wie "schwabbeln" oder "unförmig sein" – und es beschreibt das unkontrollierte Weinen, bei dem die Lippen zittern.
Das Wort "Blubber" wurde also nicht am Schreibtisch eines Biologen erfunden. Es wurde im Dreck und Lärm der Jagd geboren. Es beschreibt perfekt sowohl das Geräusch beim Verarbeiten als auch die wabbelige Konsistenz der Fettschicht.
Kein schönes Wort, aber ein verdammt ehrliches. Es fasst die rohe, ungeschminkte Natur dieses Materials perfekt zusammen.
Der Prozess war brutal und industriell:
Die Jagd: Die Robben wurden in riesigen Mengen an ihren Kolonien an Land oder auf dem Eis getötet.
Das Flensen: Der Blubber wurde in großen Stücken vom Körper der Tiere geschnitten.
Das Auskochen (Rendering): Dieser feste Blubber wurde dann in riesigen Kesseln, den sogenannten "Trankesseln", erhitzt und ausgekocht. Durch diesen Prozess schmolz das Fett und trennte sich vom restlichen Gewebe. Was übrig blieb, war reines, klares, flüssiges Robbenöl, auch "Tran" genannt.
Und wofür zum Teufel brauchte man dieses Öl so dringend?
Für verdammt noch mal ALLES, was unsere moderne Welt erst möglich gemacht hat:
Beleuchtung: Bevor die Glühbirne kam, brannten in den Häusern und auf den Straßen der Städte Öllampen. Robben- und Waltran war der beste Brennstoff, den es gab. Er brannte hell, relativ geruchsarm und rußte weniger als andere Fette. Die Nächte der westlichen Welt wurden buchstäblich mit dem Fett von Meeressäugern erhellt.
Schmiermittel: Die industrielle Revolution lief auf Hochtouren. All die neuen Maschinen, die Dampfmaschinen, die Webstühle, die Lokomotiven – all ihre Achsen und Gelenke brauchten Schmierung. Und was war das beste Schmiermittel, bevor es mineralische Öle gab? Genau, Robben- und Waltran. Ohne dieses Öl wäre die Industrie im wahrsten Sinne des Wortes heißgelaufen und hätte gefressen.
Industrielle Produktion: Das Öl wurde gebraucht, um Leder geschmeidig zu machen (Gerberei), Seife herzustellen, Farben zu produzieren und sogar, um die ersten Formen von Margarine zu fertigen.
Nahrung/Medizin: In manchen Kulturen wurde der Tran auch als Nahrungsergänzungsmittel gegessen – eine absolute Kalorienbombe und reich an Omega-3-Fettsäuren.
Die Bestände waren teilweise kurz vor dem Aus. Aber, und das ist das, was uns in der Möwen-Crew immer wieder antreibt: Es ist noch nicht alles verloren.
Dank knallharter Schutzgesetze, wie dem Seehundjagdverbot welches seit 1974 in Kraft getreten ist und unermüdlicher Arbeit von NGOs erholen sich die Bestände langsam wieder. An unseren Küsten sind Seehunde und Kegelrobben wieder ein alltäglicher Anblick. Das ist ein riesiger Erfolg!
Organisationen wie der BUND in Mecklenburg-Vorpommern bauen Netzwerke von ehrenamtlichen Robbenbetreuern auf. Diese Leute rücken aus, wenn eine Robbe am Strand gemeldet wird, errichten Schutzzonen und klären die Selfie-Touristen auf. In Orten wie Friedrichskoog oder Norddeich gibt es Seehundstationen, die verwaiste Heuler aufpäppeln und wieder auswildern. Das ist Naturschutz an vorderster Front, direkt am Strand.
Auch die Wissenschaft leistet ihren Beitrag. Das Deutsche Meeresmuseum in Stralsund sammelt Sichtungsdaten, um die Wanderungsrouten und die Gesundheit der Populationen zu überwachen. Jeder von euch kann dort seine Beobachtungen melden und so zum Schutz der Tiere beitragen.
Und was ist mit dem Konflikt mit der Fischerei? Ja, den gibt es. Robben sind schlau und bedienen sich manchmal an Netzen. Aber anstatt die Tiere einfach abzuknallen, wie es einige immer noch fordern, werden innovative Lösungen entwickelt. Forscher arbeiten an robbensicheren Fanggeräten und akustischen Vergrämungssystemen, die die Tiere von den Netzen fernhalten, ohne sie zu verletzen. Das ist der Weg, nicht der Rückfall in archaische Verfolgungsmethoden.
Der Tritt in den Hintern: Was DU jetzt tun musst
So, und jetzt kommst du ins Spiel. Hör auf, nur dazusitzen und zu nicken. Hoffnung ist kein passives Gefühl, sondern eine verdammte Verpflichtung zum Handeln. Hier ist deine To-Do-Liste:
HALTE ABSTAND! Das ist die wichtigste Regel. Wenn du eine Robbe am Strand siehst, ist sie nicht gestrandet oder hilflos. Sie ruht sich aus. Das ist überlebenswichtig für sie. Die offizielle Empfehlung lautet: Mindestens 100 Meter Abstand halten. Versperre niemals den Fluchtweg ins Wasser. Leine deinen verdammten Hund an! Ein freilaufender Hund ist für eine Robbe purer Stress und kann zur Trennung von Mutter und Jungtier führen.
FINGER WEG! Fass die Tiere nicht an. Füttere sie nicht. Wirf nichts nach ihnen. Du bist kein Tierarzt und kein Robbenflüsterer. Du bist ein potenzieller Störfaktor. Wenn du dir Sorgen machst, weil das Tier offensichtlich verletzt ist, ruf die Profis. Melde deine Sichtung bei der nächsten Seehundstation oder dem zuständigen Robbenbetreuer (Nummern findet man online, z.B. beim BUND oder den Nationalparkverwaltungen).
UNTERSTÜTZE DIE PROFIS! Die Seehundstationen und Schutzprojekte brauchen Geld. Eine kleine Spende bewirkt mehr als tausend Likes für ein süßes Robben-Foto. Werde Fördermitglied oder übernimm eine Patenschaft für einen Heuler.
KONSUMIERE MIT HIRN! Der Klimawandel ist eine massive Bedrohung für Robben, besonders für die arktischen Arten, denen das Eis unter den Flossen wegschmilzt. Reduziere deinen CO2-Fußabdruck. Falls du noch Fisch isst, dann kauf Fisch aus “nachhaltiger” Fischerei, um Beifang zu reduzieren, bei dem unzählige Robben qualvoll ertrinken.
SEI EIN MEGAPHON! Du hast den alten Gary jetzt gehört. Gib den Krawall weiter. Wenn du am Strand siehst, wie jemand eine Robbe bedrängt, sprich ihn an. Sei höflich, aber bestimmt. Viele Leute sind nicht böswillig, nur ahnungslos. Aufklärung ist unsere schärfste Waffe gegen die Ignoranz.
Robben brauchen keine Selfies, sie brauchen Respekt. Sie brauchen keine Streicheleinheiten, sie brauchen Abstand. Und sie brauchen keine Bewunderer, sie brauchen engagierte Beschützer.

Wir haben es in der Hand. Wir haben bewiesen, dass wir diese faszinierenden Tiere an den Rand der Ausrottung bringen können. Jetzt müssen wir beweisen, dass wir auch klug und demütig genug sind, um mit ihnen zusammenzuleben und ihnen den Raum zu geben, den sie zum Überleben brauchen. Eine glückliche Robbe braucht nicht viel: sauberes Wasser, genug zu fressen und einen ruhigen Platz zum Rasten. Sorgen wir dafür, dass sie den auch bekommt.
Ansonsten, und das ist kein Seemannsgarn, komme ich persönlich vorbei und erklär's dir nochmal. Und glaub mir, das willst du nicht.
Gary Gullson, für die Möwen-Crew. Ende des Berichts.
Klartext braucht eine starke Crew.
The Ocean Tribune ist zu 100% unabhängig, werbefrei und für alle frei zugänglich. Wir lassen uns von keiner Lobby kaufen, weil wir nur einer Sache verpflichtet sind: dem Ozean.
Das ist nur möglich, weil eine Crew von unerschrockenen Unterstützern hinter uns steht, die diesen Kurs finanziert. Wenn du unsere Arbeit wertvoll findest, dann werde jetzt Teil dieser Bewegung. Jeder Beitrag ist Treibstoff für unsere Mission und sorgt dafür, dass wir weiter die unbequemen Wahrheiten aussprechen können.
Aus der Werkstatt: Vom Problem zur Lösung
Aufklärung ist der erste Schritt. Die Umsetzung der zweite. Wir bei Vita Loom Labs entwickeln die professionellen Werkzeuge und strategischen Prozesse, die Impact-Organisationen dabei helfen, ihre Missionen wirkungsvoller zu machen.
Sie wollen sehen, wie unser strategischer Prozess in der Praxis aussieht? Unsere 'Blueprint Case Study' demonstriert Schritt für Schritt, wie wir aus einer guten Idee einen unwiderstehlichen, förderfähigen Antrag schmieden.
The Ocean Tribune
Wir wissen, was die Ozeane zu sagen haben!