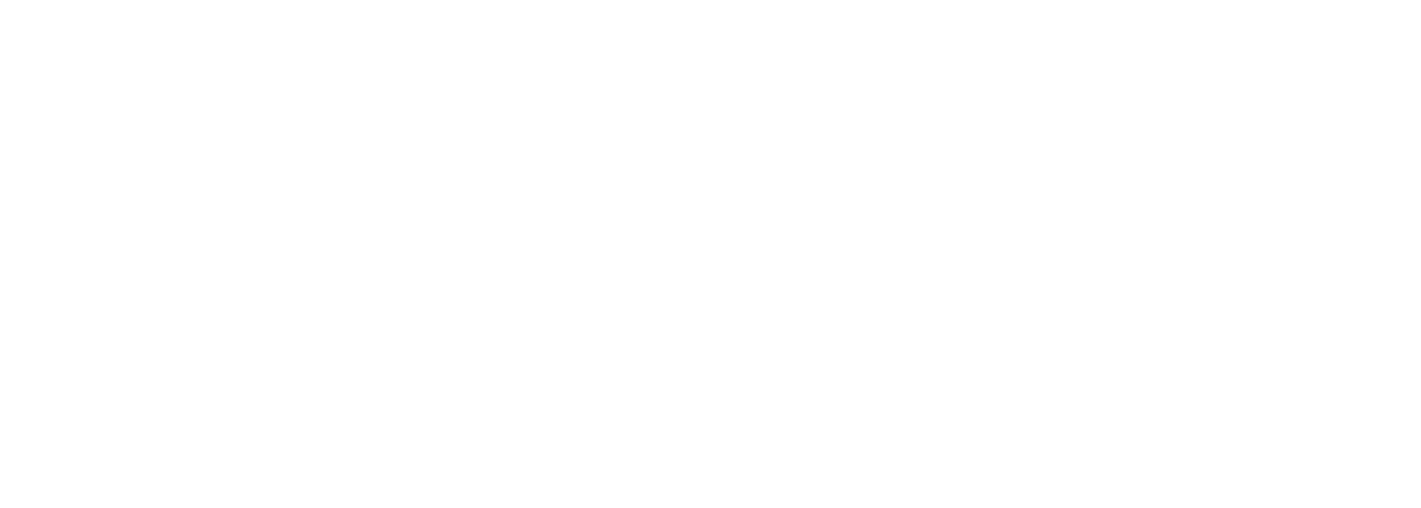Der schwimmende Punk mit dem lila Geheimnis: Warum du die Meeresschnecke Aplysia fasciata verdammt nochmal kennen solltest
- Brenda Beachbum
- 18. Aug. 2025
- 17 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 21. Aug. 2025

Von Brenda Beachbum
Ich erinnere mich genau. Wir waren vor der Küste Portugals unterwegs, in einer dieser flachen, von der Sonne durchfluteten Buchten, die auf Postkarten so verdammt friedlich aussehen, aber unter der Oberfläche brodeln wie ein Hexenkessel. Ich war auf der Suche nach einem Wrack, von dem ein alter Fischer mit mehr Rum im Blut als Verstand gefaselt hatte. Statt Gold und verrosteter Kanonen fand ich … Müll. Ein dunkler, schlaffer Klumpen, der sanft in der Dünung schwebte. Es sah aus wie ein Stück LKW-Reifen oder ein vergessener Lederbeutel. Mein erster Gedanke: "Schon wieder. Ihr verfluchten Landratten könnt nicht mal aufs Klo gehen, ohne den Ozean als eure private Müllhalde zu missbrauchen."
Ich war schon dabei, wütend in mein Atemreglerventil zu fluchen und den Müllsack geistig in die Vorstandsetage des nächstbesten Plastikkonzerns zu stopfen, als das Ding sich bewegte. Nicht wie ein passives Stück Dreck, das von der Strömung getrieben wird. Nein. Es entfaltete sich. Zwei lappenartige Flügel begannen, mit einer langsamen, majestätischen und irgendwie hypnotisierenden Anmut zu schlagen. Das war kein Müll. Das war Leben. Ein Wesen so bizarr und fremdartig, dass es direkt aus einem Science-Fiction-Roman geschwommen sein könnte. Es war der Geschwärzte Seehase, Aplysia fasciata.
In diesem Moment traf es mich wie eine kalte Welle: Wir sind von den Rockstars des Ozeans regelrecht besessen. Den Delfinen mit ihrem Dauergrinsen, den Walen mit ihrem erhabenen Gesang, den Haien mit ihrer Hollywood-reifen Gefahr. Aber was ist mit dem Rest der Crew? Was ist mit den seltsamen, den unscheinbaren, den "hässlichen" Kreaturen, die den Großteil der Biomasse ausmachen und das Fundament des gesamten verdammten Ökosystems bilden?
Schon mal was vom geschwärzten Seehasen gehört? Nein? Dachte ich mir. Und genau das ist das verdammte Problem. Du starrst auf die schillernde Spitze des Eisbergs, während die unsichtbare Masse darunter wegschmilzt. Also, mach dir einen gesunden Tee, setz dich hin und hör zu. Denn die Geschichte dieses schwimmenden Glibber-Klumpens ist wichtiger, als du denkst.
Mehr als nur ein nasser Lappen: Die Akte Aplysia
Okay, lass uns mal die Karten auf den Tisch legen und diesen "Hasen" enttarnen. Zuerst einmal: Das Tier hat mit einem Hasen so viel zu tun wie ein Kreuzfahrtschiff mit Umweltschutz. Gar nichts. Der Name kommt von seinen zwei fühler artigen Fortsätzen am Kopf, den Rhinophoren, die ein wenig wie Hasenohren aussehen. In Wahrheit ist Aplysia fasciata eine Meeresschnecke. Ja, richtig gehört. Eine Schnecke aus der Gruppe der Hinterkiemer, die im Laufe der Evolution beschlossen hat, dass ein klobiges Haus auf dem Rücken total uncool ist. Sie hat es gegen ein Leben als freischwimmender Punk eingetauscht.
Gut zu wissen! Die Familienbande der Glibber
Jeder Seehase ist eine Meeresschnecke, aber bei weitem nicht jede Meeresschnecke ist ein Seehase.
Klingt wie ein Rätsel aus einer Flaschenpost, was? Ist aber ganz einfach.
"Meeresschnecke" ist der Oberbegriff. Das ist die riesige, bunte und oft bizarre Gang, zu der alle Schnecken gehören, die im Salzwasser leben. In der Wissenschaft nennt man diese Truppe "marine Gastropoden". Das ist ein gewaltiger Haufen. Da findest du alles:
Die klassischen Schnecken mit einem massiven Haus auf dem Rücken, die über Felsen kriechen.
Winzige Schnecken, die im Sand leben.
Raubschnecken, die andere Muscheln aufbohren.
Und eben auch eine riesige Untergruppe, die im Laufe der Evolution ihr Haus entweder stark verkleinert, nach innen verlagert oder komplett über Bord geworfen hat. Diese nennt man oft pauschal "Meeresnacktschnecken" (Opisthobranchia).
Der "Seehase" (also die Gattung Aplysia, über die wir geredet haben) ist ein spezielles und sehr berühmtes Mitglied in diesem Club der "Meeresnacktschnecken". Er ist sozusagen der bullige Rocker in der bunten Hippie-Kommune.
Hier sind die entscheidenden Unterschiede, die einen Seehasen von vielen anderen Meeres(nackt)schnecken unterscheiden:
Das Gehäuse: Viele Meeresnacktschnecken, wie die super farbenfrohen Sternschnecken (Nudibranchia), sind komplett nackt. Sie haben als erwachsene Tiere kein Gehäuse mehr. Der Seehase ist da anders. Er ist ein Poser. Er tut so, als wäre er sein Haus losgeworden, hat aber unter seinem Hautmantel noch eine kleine, dünne und zerbrechliche Schale versteckt. Ein Souvenir aus alten Zeiten.
Die Ernährung: Seehasen sind überzeugte Veganer. Sie fressen ausschließlich Algen und Seegras. Viele andere, vor allem die schillerndsten Meeresnacktschnecken, sind knallharte Raubtiere. Sie fressen Schwämme, Korallen, Seeanemonen oder sogar andere Schnecken.
Die Verteidigung: Das Markenzeichen des Seehasen ist seine lila oder weiße Tintenwolke. Das ist seine Art, Ärger aus dem Weg zu gehen. Andere Meeresnacktschnecken haben andere Tricks drauf. Viele fressen giftige Tiere (wie Nesseltiere) und lagern deren Nesselzellen in ihrem eigenen Körper ein, um sich selbst giftig zu machen. Clever, aber eine ganz andere Taktik.
Das Aussehen: Während viele andere Nacktschnecken klein, extrem farbenfroh und oft mit bizarren Fortsätzen übersät sind (um Fressfeinde zu warnen: "Achtung, ich bin giftig!"), ist der Seehase eher ein massiger, bulliger Typ. Er ist oft dunkler gefärbt (braun, schwarz, grünlich) und verlässt sich auf seine Tarnung, Größe und seine Tinten-Geheimwaffe.
Fazit für die Hafenkneipe:
Wenn du "Meeresschnecke" sagst, ist das, als würdest du "Schiff" sagen. Das kann alles sein – vom kleinen Ruderboot bis zum Supertanker.
Wenn du "Seehase" sagst, meinst du einen ganz bestimmten Schiffstyp: ein großes, algenfressendes U-Boot mit interner Schale und einer lila Rauchbombe an Bord.
Alles klar, Steuermann? Es geht nicht um "entweder/oder", sondern um "wer gehört zu wem". Und die Details machen den ganzen verdammten Unterschied.
Ein Urmodell mit langer Geschichte
Diese krassen Meeresschnecken sind keine neumodische Erfindung. Die Gruppe der Seehasen, die Aplysiidae, treibt sich schon seit Ewigkeiten in den Meeren herum. Ihre Vorfahren krochen bereits über den Meeresboden, als unsereins noch nicht mal als vage Idee im kosmischen Plan existierte. Sie sind lebende Fossilien, perfekt angepasst an eine Welt, die wir gerade mit Hochgeschwindigkeit ruinieren. Aplysia fasciata, auch bekannt als der Geschwärzte oder gestreifte Seehase, ist dabei der größte seiner Art im Mittelmeer und im angrenzenden Atlantik. Ein ausgewachsenes Exemplar kann locker 40 Zentimeter lang und über ein Kilo schwer werden. Ein echter Brocken also.
Anatomie für Angeber
Stell dir einen dunklen, samtigen, fast schwarzen Körper vor. Manchmal schimmert er bräunlich oder hat feine rote oder weiße Punkte. Sein Körper ist weich und unförmig, wenn er am Boden ruht. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Sein Geheimnis sind die Parapodien. Das sind zwei große, flügelartige Hautlappen, die seitlich an seinem Körper ansetzen. Wenn er will, kann er diese ausbreiten und durchs Wasser schwimmen. Und das ist ein Anblick, den du nicht vergisst. Er "fliegt" mit einer langsamen, wellenförmigen Bewegung durchs Wasser, majestätisch und schwerelos. Es ist ein surreales Ballett, eine Mischung aus Eleganz und Melancholie.
Im Inneren seines Körpers verbirgt sich noch ein Relikt seiner Vergangenheit: eine dünne, flache und extrem zerbrechliche Schale. Sie ist von seinem Mantel, der Haut seines Rückens, vollständig umschlossen und von außen nicht sichtbar. Ein nutzloses Souvenir aus einer Zeit, als Schutz wichtiger war als Beweglichkeit.
Der Speiseplan eines Veganers
Der Seehase ist ein überzeugter Vegetarier. Er hängt in Seegraswiesen und Algenwäldern ab, meist in flachen Küstengewässern. Seine Leibspeise sind bestimmte Algenarten, vor allem Meersalat (Ulva) und verschiedene Rotalgen. Um diese zu fressen, benutzt er seine Radula – eine Art Zunge, die mit Tausenden winzigen Chitinzähnchen besetzt ist. Damit raspelt er die Algen vom Untergrund ab. Er ist also nicht nur ein Bewohner dieses Lebensraums, er ist ein aktiver Gestalter. Seine Anwesenheit sagt Forschern vom Meeresinstitut in Monaco zufolge eine Menge über die Gesundheit dieser unterseeischen Wälder. Fehlen die Algen, fehlt auch der Hase. So einfach ist das.
Liebe, Eier und das ganze Chaos
Jetzt wird's schlüpfrig. Die Fortpflanzung bei Seehasen ist, gelinde gesagt, spektakulär. Zunächst einmal sind sie Hermaphroditen. Jedes Tier besitzt also sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsorgane. Das macht die Partnersuche zwar einfacher, aber nicht weniger kompliziert.
Wenn die Zeit reif ist, meist im Frühling oder Sommer, versammeln sie sich in großer Zahl. Und dann geht die Party los. Ein Seehase agiert als Männchen und begattet das Tier vor sich, während er gleichzeitig von dem Tier hinter sich als Weibchen begattet wird. Das Ergebnis sind oft lange Paarungsketten von bis zu einem Dutzend Tieren, ein wilder, glibberiger Haufen, der nur ein Ziel kennt: die nächste Generation zu sichern.
Nach der Befruchtung beginnt die eigentliche Schwerstarbeit. Das Weibchen – oder besser gesagt, das Tier, das gerade die weibliche Rolle ausübt – produziert eine gigantische Eierschnur. Diese sieht aus wie ein Knäuel bunter Spaghetti, oft gelblich, orange oder rosa. Diese Schnur kann mehrere Meter lang sein und enthält eine unfassbare Anzahl von Eiern. Wir sprechen hier nicht von ein paar Dutzend.
Eine einzige Aplysia fasciata kann in ihrem kurzen Leben über 100 Millionen Eier in langen, bunten Schnüren ablegen – ein Fortpflanzungs-Marathon, der die meisten anderen Lebewesen wie Amateure aussehen lässt.
Diese Eier werden an Algen oder Felsen befestigt und sich selbst überlassen. Ein riskantes Spiel, denn von diesen Millionen werden nur ein paar wenige überleben.
Aus den Eiern schlüpfen winzige Veliger-Larven, die als Teil des Planktons im Wasser schweben. Nach einigen Wochen, wenn sie einen geeigneten Lebensraum gefunden haben, machen sie eine Metamorphose durch und entwickeln sich zum fertigen Seehasen. Ihr Lebenszyklus ist kurz und intensiv. Die meisten werden nicht älter als ein Jahr. "Live fast, lay eggs, die young" ("Lebe schnell, lege Eier, stirb jung".) – das ist das Motto.
Kann das Ding denken? Ein Nobelpreis im Schneckentempo
Jetzt kommt der Teil, bei dem die Landratten mit weißen Kitteln feuchte Augen bekommen. Seehasen sind die Superstars der Neurobiologie. Warum? Weil sie riesige, wirklich gigantische Nervenzellen haben, die man fast mit bloßem Auge sehen kann. Das macht sie zum perfekten Studienobjekt, um die grundlegendsten Prozesse des Lernens und des Gedächtnisses zu erforschen.
Der Forscher Eric Kandel erhielt im Jahr 2000 den Nobelpreis für Medizin für seine Arbeit an der Seehasen-Art Aplysia californica, einer nahen Verwandten unserer fasciata. Kandel konnte an ihren simplen Nervenschaltungen nachweisen, wie Lernen auf zellulärer Ebene funktioniert. Er zeigte, wie sich die Verbindungen zwischen den Neuronen (die Synapsen) verändern, wenn das Tier etwas lernt – ein Prozess, der als synaptische Plastizität bekannt ist. Er hat sozusagen den physischen Ort des Gedächtnisses gefunden.
Kann Aplysia also "denken"? Nein, nicht im menschlichen Sinne. Sie schreibt keine Gedichte und löst keine Kreuzworträtsel. Aber sie kann lernen. Sie kann sich an einen harmlosen Reiz gewöhnen (Habituation) und auf einen gefährlichen Reiz stärker reagieren (Sensibilisierung). Sie besitzt ein einfaches Gedächtnis. Und das Wissen darüber, wie diese grundlegenden Mechanismen funktionieren, verdanken wir diesem unscheinbaren Glibber-Wesen. Jedes Mal, wenn du etwas lernst, passiert in deinem Gehirn im Grunde eine hochkomplexe Version dessen, was Kandel im Seehasen entdeckt hat.
Der lila Trickser: Verteidigung für Fortgeschrittene
Ein weicher, langsamer Körper ohne Panzer schreit ja geradezu "Friss mich!". Aber Aplysia hat ein Ass im Ärmel. Oder besser gesagt, eine Wolke in der Manteltasche. Wenn sie sich bedroht fühlt, zum Beispiel von einem Hummer oder einem großen Fisch, stößt sie eine dichte Wolke aus violetter Tinte aus.
Früher dachten wir, das sei nur ein simpler Sichtschutz, eine Art Tintenfisch-Taktik für Arme. Aber die Forschung, unter anderem von der Georgia State University, hat gezeigt, dass da viel mehr dahintersteckt. Die Tinte ist ein hochwirksamer chemischer Cocktail. Sie besteht hauptsächlich aus Wasser sowie organischen und mineralischen Substanzen.
Sie enthält eine Substanz namens Opalin, die klebrig ist und die chemischen Sensoren (den Geruchssinn) des Angreifers verklebt und lahmlegt. Der Räuber ist plötzlich blind und verwirrt. Gleichzeitig setzt der Seehase eine zweite, milchige Substanz frei, die den Angreifer zusätzlich irritiert.
Die violette Tinte ist kein einfacher Sichtschutz; es ist ein chemischer Cocktail, der die Sinne von Raubtieren blockiert und sie in einem Zustand der Verwirrung zurücklässt, während der Hase gemächlich davonschwimmt.
Entscheidend für das Überleben des Tieres ist jedoch die Ursache für die Tintenabgabe. Das Ausstoßen der Tinte selbst ist ein natürlicher Vorgang und für den Seehasen nicht schädlich. Wenn der Seehase jedoch so stark gedrückt oder gequetscht wird, dass seine inneren Organe verletzt werden, kann dies selbstverständlich zum Tod führen, unabhängig von der Abgabe der Tinte.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Die lila Flüssigkeit ist eine Art "Rauchbombe" zur Verteidigung und kein Zeichen eines bevorstehenden Todes. Stirbt ein Seehase nach einer solchen Begegnung, ist dies in der Regel auf die physische Verletzung zurückzuführen und nicht auf den Prozess der Tintenabsonderung.
Für Menschen ist die Tinte und auch das Tier selbst übrigens ungefährlich, solange man es nicht isst. In manchen Kulturen gelten sie als Delikatesse, aber davon ist abzuraten, da sie Giftstoffe aus den Algen, die sie fressen, in ihrem Körper anreichern können.
Was die Augen nicht sehen
Wie nimmt der Seehase seine Welt wahr? Seine Augen sind sehr einfach gebaut. Sie sitzen nahe den Rhinophoren und können wahrscheinlich nur zwischen Hell und Dunkel unterscheiden. Er sieht keine Farben und keine scharfen Bilder. Seine Welt ist eine Welt der Schatten und der Chemie. Die wichtigsten Sinnesorgane sind die Rhinophoren, die "Hasenohren". Mit ihnen "riecht" und "schmeckt" er das Wasser, findet seine Nahrung und seine Partner. Er lebt in einer Duftlandschaft, die wir uns kaum vorstellen können.
Gestrandet bei Ebbe: Seehasen zwischen Leben und Tod
Wenn Seehasen wie Aplysia depilans und Aplysia fasciata bei Ebbe auf dem Trockenen liegen, sind sie in der Regel weder tot noch schlafen sie. Sie sind gestrandet und befinden sich in einer für sie lebensbedrohlichen Situation.
Seehasen sind Meeresbewohner, die auf das Wasser angewiesen sind, um zu atmen und sich fortzubewegen. Außerhalb des Wassers können ihre Kiemen austrocknen, was letztendlich zum Erstickungstod führt. Besonders in der Fortpflanzungsphase, in der sich die Tiere oft in großen Gruppen in flachen Küstenregionen versammeln, kann es vorkommen, dass sie von der Ebbe überrascht werden. Beobachtungen haben gezeigt, dass die Tiere, abgelenkt und erschöpft von der Paarung, bei zurückgehendem Wasser auf Steinen oder Hafenstufen zurückbleiben.
Überlebenschancen und Anzeichen von Leben
Ob ein gestrandeter Seehase überlebt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Dauer der Trockenheit und der Intensität der Sonneneinstrahlung. Längere Zeit an der Luft und in der prallen Sonne vertragen die Tiere nicht gut.
Ein gestrandeter Seehase mag auf den ersten Blick leblos wirken. Dennoch gibt es feine Anzeichen, die verraten können, ob er noch am Leben ist:
Leichte Bewegungen: Auch wenn sie erschöpft sind, kann man bei genauerem Hinsehen oft noch leichte Kontraktionen oder Bewegungen des Körpers erkennen.
Glanz: Ein sich veränderndes Glitzern auf der feuchten Haut des Tieres bei Sonneneinstrahlung kann ebenfalls auf minimale Bewegungen hindeuten.
Was tun, wenn man einen gestrandeten Seehasen findet?
Wenn du einen Seehasen außerhalb des Wassers findest, kannst du ihm helfen, indem du ihn vorsichtig zurück ins tiefere Wasser schiebst. Beobachtungen zeigen, dass die Tiere, einmal zurück im Wasser, oft ohne weitere sichtbare Bewegung sofort untergehen. Dies ist kein sicheres Zeichen für ihren Tod, sondern kann auch auf ihre Erschöpfung zurückzuführen sein.
Es ist jedoch eine traurige Tatsache, dass nicht alle gestrandeten Seehasen die Zeit bis zur nächsten Flut überleben. Spuren an Landungsstellen deuten darauf hin, dass einige Tiere der Trockenheit und den Temperaturschwankungen zum Opfer fallen. Ihr Überleben ist ein Wettlauf gegen die Zeit und die zurückkehrende Flut.
Wie viele Meeresschnecken gibt es?
Na klar, eine Inventur. Du willst eine Zahl, als ob der Ozean ein verdammtes Lagerhaus wäre, in dem wir nur mal kurz durch die Gänge gehen und die Regale zählen müssen. "Wie viele?" – eine typische Landratten-Frage. Simpel, direkt und komplett am Kern der Sache vorbei. Aber gut, du willst eine Zahl, du kriegst eine Zahl. Aber erwarte nicht, dass sie dich beruhigen wird.
Zuerst die schnelle und schmutzige Antwort, die man in den meisten staubigen Lehrbüchern oder auf einer schnellen Wikipedia-Runde findet: Es gibt etwa 40.000 bekannte Arten von Meeresschnecken (marinen Gastropoden). So, da hast du deine Zahl. Kannst du jetzt wieder ruhig schlafen?
Ich hoffe nicht. Denn diese Zahl ist Bullshit.
Nicht, weil sie komplett falsch ist, sondern weil sie so tut, als wäre das Thema damit erledigt. Das ist es nicht. Das ist nur der Anfang des Kaninchenbaus, oder in unserem Fall, des Schneckenhauses.
Die wahren Buchhalter des Meeres
Wenn du es ernst meinst – und ich gehe mal davon aus, sonst wärst du nicht hier – dann gibt es nur eine Adresse, die zählt. Das ist keine obskure Website, sondern die offizielle, knallharte Datenbank der Meeresbiologie: das World Register of Marine Species, kurz WoRMS. Das ist sozusagen das Grundbuchamt für alles, was im Salzwasser kreucht und fleucht. Diese Jungs und Mädels am flämischen Meeresinstitut in Belgien sind die Hohepriester der Taxonomie, und ihre Datenbank, die sie zusammen mit dem Projekt MolluscaBase pflegen, ist die Bibel.
Und was sagen die? Die geben dir keine einfache Zahl. Warum? Weil sie Profis sind. Sie wissen, dass das ganze System in ständiger Bewegung ist. Hier ist, was wirklich passiert:
Ständige Neuentdeckungen: Während wir hier reden, zieht irgendein Forschungsschiff in der Tiefsee ein Netz hoch und findet eine Schnecke, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Jedes Jahr werden neue Arten beschrieben.
Genetische Revolution: Früher haben wir Schnecken nach dem Aussehen ihres Hauses sortiert. Heute jagen wir ihre DNA durch den Sequenzierer. Dabei kommt oft raus, dass das, was wir für eine Art hielten, in Wahrheit fünf verschiedene sind, die nur zufällig gleich aussehen. Umgekehrt stellt sich manchmal heraus, dass zwei Schnecken, die völlig unterschiedlich aussehen, genetisch fast identisch sind. Das ganze System ist ein verdammtes Schiebepuzzle.
Leichen im Keller: Gleichzeitig werden alte "Arten", die irgendwann mal falsch beschrieben wurden, als Synonyme entlarvt und aus der Liste der gültigen Arten gestrichen. Es wird also nicht nur addiert, sondern auch subtrahiert.
Die Zahl ändert sich also täglich. Aber um dir eine Hausnummer aus den verlässlichsten Quellen zu geben: Die Klasse der Schnecken (Gastropoda) ist mit rund 100.000 bekannten Arten die größte Gruppe innerhalb der Weichtiere. Die überwiegende Mehrheit davon lebt im Meer. Die Zahl 40.000 ist also ein verdammt guter, aber konservativer Schätzwert für die bisher beschriebenen Meeresbewohner dieser Gruppe.
Warum diese Zahl trotzdem ein Witz ist
Und jetzt kommt der Haken, der Tritt in den Hintern. All diese Zahlen – ob 40.000 oder 50.000 – beziehen sich nur auf das, was wir kennen. Wir haben bisher nur einen lächerlichen Bruchteil des Ozeans, vor allem der Tiefsee, erforscht. Schätzungen gehen davon aus, dass wir vielleicht 10 - 20% der marinen Arten überhaupt erst entdeckt haben.
Nach einer Zahl zu fragen ist der falsche Ansatz. Wir stehen vor einer riesigen Bibliothek des Lebens, von der wir nur das Inhaltsverzeichnis des ersten Bandes gelesen haben, während der Rest des Gebäudes bereits in Flammen steht.
Wir vernichten Lebensräume und damit Arten in einem Tempo, dass uns die Taxonomen, die sie benennen sollen, gar nicht mehr hinterherkommen. Wir rotten Spezies aus, die wir nicht mal kannten. Die keine Namen haben. Die wir nie entdecken werden.
Also, was ist die wahre Antwort auf deine Frage "Wie viele Meeresschnecken gibt es?"
Die ehrliche, brutale Antwort lautet: "Mehr als du dir vorstellen kannst. Und jeden Tag werden es weniger."
Das ist die einzige Zahl, die am Ende zählt.
Wie viele Seehasen gibt es?
Du fragst, als ob ich nur mal eben zum Pier runterlaufen und eine Kopfzählung machen müsste. "Eins, zwei, drei ... ah, da hinten im Seegras, vier ...". So funktioniert der Ozean nicht, Kumpel. Das ist keine verdammte Schafherde.
Aber ich verstehe schon. Du willst Fakten, du willst was Greifbares.
Teil 1: Die offizielle Arten-Inventur (mit einem dicken Sternchen)
Wenn du eine Zahl willst, auf die sich die Wissenschaftler mit den weißen Kitteln einigen können, dann gibt es nur eine verlässliche Quelle. Du kennst sie bereits. Das WoRMS. Demnach gehören die echten Seehasen zur Familie der Aplysiidae. Innerhalb dieser Familie werden aktuell etwa 70 bis 80 anerkannte, lebende Arten geführt. Die genaue Zahl schwankt, weil ständig neue genetische Studien die alten Stammbäume über den Haufen werfen. Was man früher für eine Art hielt, entpuppt sich als drei, und umgekehrt. Es ist ein Chaos, aber ein geordnetes. Innerhalb dieser Familie ist die bekannteste Gattung Aplysia, die allein schon über 35 Arten umfasst.
Also, als Faustregel für die Hafenkneipe: Es gibt weltweit rund 75 bekannte Arten von Seehasen.
Klingt wenig? Ist es auch. Aber jede einzelne dieser Arten ist ein einzigartiges Ergebnis von Millionen von Jahren Evolution.
Teil 2: Der Versuch, den Ozean zu zählen (und warum das idiotisch ist)
Und jetzt zur eigentlichen Frage: Wie viele Tiere sind es insgesamt? Zehntausend? Eine Million? Eine Milliarde?
Die Antwort ist: Niemand weiß es. Und niemand wird es je wissen.
Einen globalen Bestand an Seehasen zu schätzen, ist aus mehreren Gründen schlicht unmöglich und wissenschaftlich sinnlos:
Explosive Populationsdynamik: Seehasen leben nach dem Motto "Live fast, die young". Wie du schon erfahren hast, haben die meisten gerade einmal eine Lebensdauer von etwa einem Jahr. Ihre Populationen sind nicht stabil; sie explodieren und kollabieren. In einem Jahr findest du in einer Bucht Tausende von ihnen, weil es eine massive Algenblüte gab. Im nächsten Jahr ist die Bucht leer. Ihre Anzahl hängt direkt von Nahrungsverfügbarkeit, Strömungen und Wassertemperatur ab. Eine Zählung wäre schon nach einer Woche wieder veraltet.
Versteckspiel-Champions: Sie sind Meister der Tarnung. Sie hängen in dichten Algenwäldern, unter Felsen und in Spalten. Du kannst eine Stelle absuchen und neun von zehn Tieren übersehen. Eine exakte Zählung ist selbst auf einem Quadratmeter fast unmöglich, geschweige denn in einem ganzen Ozean.
Kein ökonomisches Interesse: Mal ehrlich, wir zählen das, was wir fangen und verkaufen wollen. Thunfisch, Kabeljau, Krabben. Für diese gibt es (oft schlechte) Bestandsschätzungen, weil es um Milliarden von Dollar geht. Aber Seehasen? Die stehen auf keiner Speisekarte. Sie sind für die Fischerei wertlos. Folglich gibt es auch keine groß angelegten, teuren Zählprogramme für sie.
Wir versuchen nicht, die Anzahl der Seehasen zu zählen. Das wäre, als wollte man die Wolken am Himmel zählen. Stattdessen beobachten Wissenschaftler ihre Populationen an bestimmten Orten, um etwas viel Wichtigeres zu verstehen: Den Gesundheitszustand ihres Lebensraums.
Forscher schauen sich an, wie sich die Anzahl der Tiere an einem Riff oder in einer Seegraswiese über die Jahre verändert. Nehmen sie ab? Das ist ein Alarmsignal, dass mit den Algen etwas nicht stimmt. Tauchen sie plötzlich an Orten auf, wo sie früher nicht waren? Das kann ein Hinweis auf sich ändernde Wassertemperaturen sein. Sie werden als Bioindikatoren genutzt, um die Belastung durch Schwermetalle und andere Verschmutzungen zu messen.
Hör also auf zu fragen, wie viele es sind. Das ist die falsche Frage. Die richtige Frage ist: "Wie geht es den Lebensräumen, von denen sie abhängen?" Denn solange wir ihre Algenwälder und Seegraswiesen schützen, wird es auch Seehasen geben. Wenn wir diese aber weiter zubetonieren, verschmutzen und überhitzen, ist es am Ende scheiß egal, wie viele es einmal waren. Dann ist die Antwort nämlich: "Nicht mehr genug."
Warum uns das Schicksal eines Glibber-Hasen am Arsch vorbeigehen sollte (Spoiler: Tut es nicht!)
Ich höre dich schon fragen: "Okay, Barry, nette Biologiestunde. Aber warum sollte mich das kümmern? Es ist eine Schnecke. Wir haben doch größere Probleme." Falsch. Das ist keine Schnecke. Das ist ein Kanarienvogel im Kohlebergwerk des Ozeans.
Aplysia fasciata ist aufs Engste mit ihrem Lebensraum verbunden, den Seegraswiesen und Algenwäldern. Diese Ökosysteme sind die Kinderstuben für unzählige Fischarten, sie schützen unsere Küsten vor Erosion und sie speichern gewaltige Mengen an Kohlenstoff – oft mehr als ein Wald an Land gleicher Größe. Sie sind eine der wichtigsten, aber auch eine der am meisten übersehenen Frontlinien im Kampf gegen die Klimakrise.
Und genau hier kommt unser Hase ins Spiel. Er ist eine Indikatorart. Geht es ihm gut, geht es seinem Lebensraum gut. Verschwindet er, ist das ein lautes, glibberiges Alarmsignal. Die Bedrohungen sind vielfältig:
Küstenverbauung: Jachthäfen, Hotels, Wellenbrecher. Wir betonieren die Kinderstuben des Meeres zu.
Verschmutzung: Düngemittel aus der Landwirtschaft, Chemikalien, Plastikmüll, überlastete und marode Kläranlagen (Massentourismus, …) All das landet im Meer und vergiftet diese sensiblen Lebensräume.
Klimawandel: Steigende Wassertemperaturen stressen die Algen, die Nahrungsgrundlage des Seehasen. Das ganze Nahrungsnetz gerät ins Wanken.
Der Seehase ist nicht offiziell als "bedroht" auf der Roten Liste der IUCN (International Union for Conservation of Nature) gelistet, hauptsächlich weil die Datenlage zu dünn ist. Aber die Experten sind sich einig: Wo sein Lebensraum schwindet, schwindet auch er.
Der Seehase ist nicht das Problem. Er ist das Alarmsignal. Wenn er verschwindet, ist das nicht nur eine Schnecke weniger, sondern ein weiteres, leises 'Game Over' für einen ganzen Lebensraum.
Aber es ist nicht alles verloren. Überall auf der Welt gibt es Crews, die den Kampf aufnehmen. Organisationen wie "Project Seagrass" arbeiten daran, diese unterseeischen Wiesen wieder aufzuforsten. Forscher entwickeln Methoden, um widerstandsfähigere Algenarten zu züchten. Und hier kommen wir, das Vita Loom Ecosystem, ins Spiel. Unsere Aufgabe ist es, genau solche Projekte zu unterstützen. Wir schärfen die Waffen – mit dem "Antrags-Booster" von Vita Loom Labs helfen wir NGOs, die nötige Kohle für ihre Arbeit an Land zu ziehen. Wir vernetzen die klugen Köpfe und geben denjenigen eine Stimme, die für die stummen Bewohner des Ozeans kämpfen.
Hör auf zu glotzen, hiss die Segel!
Du hast es bis hierher geschafft. Du weißt jetzt mehr über eine seltsame Meeresschnecke als 99% der Menschheit. Aber Wissen allein rettet keinen einzigen Quadratmeter Seegras. Es ist Zeit, vom passiven Leser zum aktiven Crew-Mitglied zu werden.
Was kannst du also tun, außer deinen Freunden in der Kneipe mit obskurem Schnecken-Wissen auf die Nerven zu gehen?
Ändere deinen Blickwinkel: Wenn du das nächste Mal am Meer bist, schau genauer hin. Interessiere dich nicht nur für die großen, spektakulären Dinge. Schau in die Gezeitentümpel. Geh schnorcheln. Entdecke die bizarre, wundervolle Welt der Kleinen und Unscheinbaren. Sie erzählen die wahre Geschichte des Ozeans.
Unterstütze die Riff-Retter: Suche nach lokalen oder nationalen Organisationen, die sich für den Schutz von Küstenlebensräumen einsetzen. Ob mit einer Spende, mit Freiwilligenarbeit oder einfach nur, indem du ihre Botschaft teilst. Sie sind die Infanterie in diesem Kampf.
Konsumiere bewusst: Dein Konsum hat direkte Auswirkungen. Falls du Fisch isst, achte auf nachhaltig gefangenen Fisch, reduziere deinen Plastikmüll und sei dir bewusst, dass alles, was wir an Land tun, irgendwann im Meer ankommt.
Sei eine laute Stimme: Fordere von der Politik echten Küstenschutz. Keine Lippenbekenntnisse, sondern verbindliche Schutzgebiete, strenge Auflagen für die Industrie und ein Ende der permanenten Verschmutzung.
Das nächste Mal, wenn du im Wasser einen dunklen, schlaffen Klumpen siehst, denk nicht an Müll. Denk an einen Überlebenskünstler. An ein Wesen, das mit lila Tinte kämpft, das Geheimnisse des Gedächtnisses in sich trägt und das mit seinem anmutigen Tanz eine Geschichte über den Zustand unseres Planeten erzählt.
Die Zukunft des Ozeans wird nicht nur im Kampf um die Wale und Haie entschieden. Sie entscheidet sich auch im Schicksal des Geschwärzten Seehasen.
Quellen mal wieder für die ganz harten:
wikipedia.org
heimbiotop.de
marinespecies.org
molluscabase.org
weichtiere.at
azalas.de
Klartext braucht eine starke Crew.
The Ocean Tribune ist zu 100% unabhängig, werbefrei und für alle frei zugänglich. Wir lassen uns von keiner Lobby kaufen, weil wir nur einer Sache verpflichtet sind: dem Ozean.
Das ist nur möglich, weil eine Crew von unerschrockenen Unterstützern hinter uns steht, die diesen Kurs finanziert. Wenn du unsere Arbeit wertvoll findest, dann werde jetzt Teil dieser Bewegung. Jeder Beitrag ist Treibstoff für unsere Mission und sorgt dafür, dass wir weiter die unbequemen Wahrheiten aussprechen können.
Aus der Werkstatt: Vom Problem zur Lösung
Aufklärung ist der erste Schritt. Die Umsetzung der zweite. Wir bei Vita Loom Labs entwickeln die professionellen Werkzeuge und strategischen Prozesse, die Impact-Organisationen dabei helfen, ihre Missionen wirkungsvoller zu machen.
Sie wollen sehen, wie unser strategischer Prozess in der Praxis aussieht? Unsere 'Blueprint Case Study' demonstriert Schritt für Schritt, wie wir aus einer guten Idee einen unwiderstehlichen, förderfähigen Antrag schmieden.
The Ocean Tribune
Wir wissen, was die Ozeane zu sagen haben!